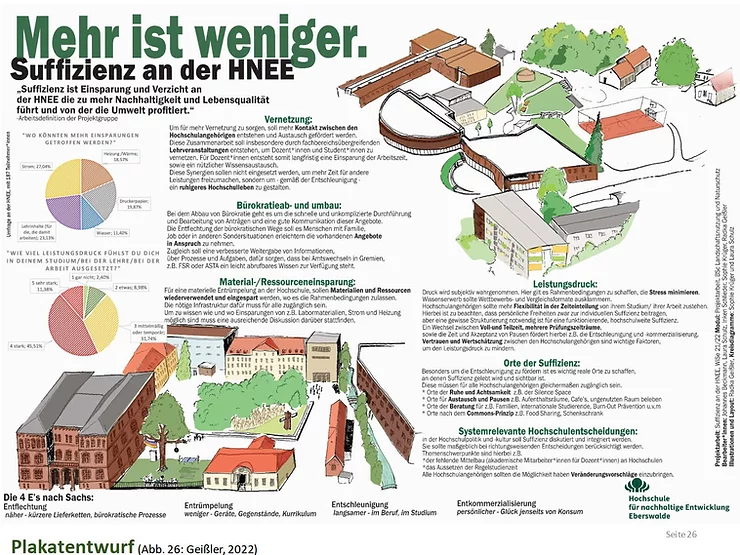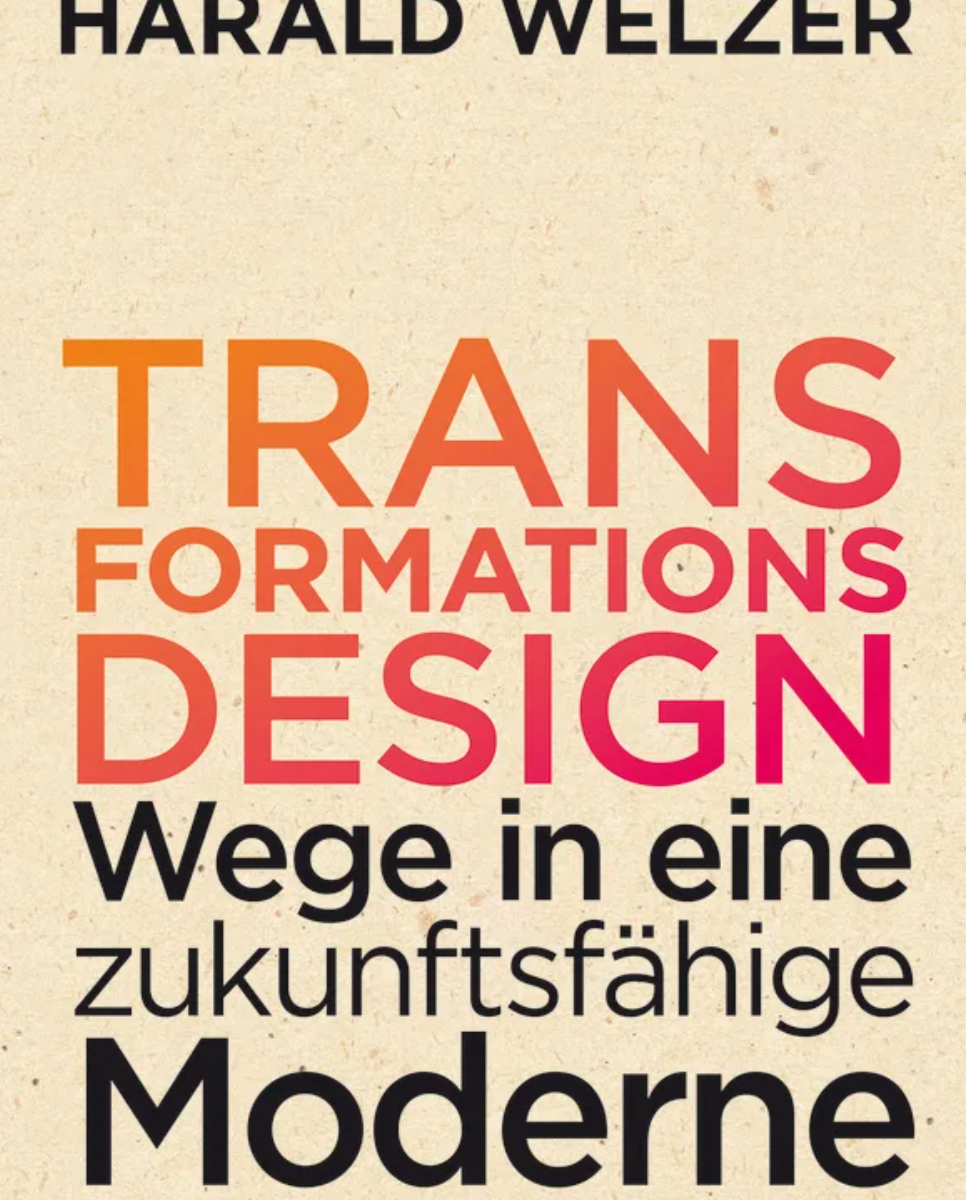Suffizienz ist neben Effizienz und Konsistenz eine der drei gleichrangigen Nachhaltigkeitsstrategien. Im Gegensatz zu den beiden stärker technisch und regulatorisch ausgerichteten Strategien setzt Suffizienz beim Bewusstsein und Handeln jedes Einzelnen an. Sie lädt uns ein, unsere etablierten Konsum- und Verhaltensmuster kritisch zu reflektieren und Neues zu erproben. Dennoch braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, um suffiziente Lebensstile Realität werden zu lassen. Welche das sind, wird gegenwärtig im mehrjährigen, länderübergreifenden Forschungsvorhaben FULFILL erforscht.
Deutsche Umweltstiftung (DUS): Sie forschen gerade im Rahmen des mehrjährigen Projekts FULFILL zum Thema Suffizienz. Bitte erläutern Sie uns kurz, worum es in Ihrem Vorhaben geht.
Dr. Preuß: FULFILL ist eine Abkürzung für den langen Projektnamen „Fundamentale Dekarbonisierung durch Suffizienz und Lebenstilveränderungen“. Aus dem Titel kann man schon erahnen, um was es geht: Wir schauen uns an, wie CO₂-Emissionen durch Veränderungen im Lebensstil und Suffizienz verringert werden können. Suffizienz kann grob beschrieben werden als „mit weniger besser leben“. Das Projekt ist international ausgerichtet, sodass wir nicht nur in Deutschland repräsentative Befragungen in der Allgemeinbevölkerung und Interviews mit Suffizienz-Initiativen durchführen, sondern dies auch in Frankreich, Italien, Dänemark, Lettland und Indien machen. Aber natürlich schaffen wir das nicht alleine. Wir sind ein Forschungskonsortium mit acht Partnern aus der Wissenschaft wie das Fraunhofer ISI, das Wuppertal Institut, EURAC und der Universität Politecnico di Milano, aber auch Think-Tanks und NGOs wie négaWatt, Jacques Delors Institut, Inforse und Zala Briviba.
Dr. Dütschke: Im weiteren Verlauf des Projektes werden auch noch umfangreiche Analysen folgen, mit welchen Politikmaßnahmen sich Suffizienz vorantreiben lässt. Und es wird noch eine umfangreiche Bewertung zu wirtschaftlichen Auswirkungen und Klimawirkungen gemacht.
DUS: In Ihrem Forschungsdesign behandeln Sie u. a. regulatorische und infrastrukturelle Maßnahmen, um suffizientes Verhalten zu ermöglichen. Wieso brauchen individuelle Verhaltensveränderungen eigentlich derartige politische Weichenstellungen?
Dr. Preuß: Weil es oftmals ohne sie nicht möglich ist. Wenn ich beispielsweise keine Möglichkeit habe, mein Fahrrad am Arbeitsplatz sicher abzustellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Weg zur Arbeit ins Auto statt aufs Fahrrad steige, sehr viel größer – auch wenn mir das Fahrradfahren gesundheitlich und mental guttun würde. Das ist nur ein Beispiel von vielen.
Dr. Dütschke: Das geht dann für viele andere Bereiche ähnlich weiter: Um auf den Trockner zu verzichten, braucht es geeignete Möglichkeiten, die Wäsche aufzuhängen – sei es im Außenbereich oder im Waschkeller. Damit verbunden ist dann aber auch die wichtige Frage, wer das im Haushalt übernimmt. In den meisten Fällen sind die Frauen dafür zuständig – hier gilt es weiterzudenken, dass Suffizienz nicht zulasten bestimmter Bevölkerungsgruppen geht.
DUS: Wenn es um ökonomische Verhaltensänderungen geht, stehen Entscheider*innen traditionell Anreiz- und Sanktionsinstrumente zur Verfügung. Welche Instrumente braucht es für eine aktive Suffizienzpolitik?
Dr. Preuß: Basierend auf den Ergebnissen aus FULFILL wissen wir das noch nicht genau, denn die Forschungsarbeiten dazu laufen gerade noch (das Projekt läuft bis September 2024). Aus anderen Forschungsprojekten wissen wir jedoch, dass ein Mix aus Push- und Pull-Maßnahmen sinnvoll erscheint. Aus psychologischer Sicht sollten Push-Maßnahmen, also Sanktionen, vor allem dann genutzt werden, wenn es um essenzielle oder gar fatale Entscheidungen bzw. Verhaltensveränderungen geht – und das tut es ja beim Klimawandel, zumindest langfristig. Aber natürlich sollten auch Anreize umgesetzt werden, um die Menschen nicht nur durch Verbote zu suffizienten Lebensstilveränderungen zu leiten. Diese Pull-Maßnahmen haben meist eine höhere Akzeptanz in der breiten Bevölkerung (im Vergleich zu Push-Maßnahmen), sind aber oft weniger effektiv, was tatsächliche Verhaltensveränderungen angeht.
Dr. Dütschke: In Frankreich gibt es für so eine Maßnahmenkombination gerade ein gutes Beispiel. Dort werden Kurzstreckenflüge verboten, wenn es alternativ eine Direktverbindung mit einem Hochgeschwindigkeitszug gibt.
DUS: Eine ergänzende Frage zu politischen Instrumenten: Aktuell wird im Zuge einer Stärkung der demokratischen Strukturen der EU viel über dialogische Bürgerbeteiligung gesprochen. Welche Bedeutung messen Sie dieser im Rahmen einer aktiven Suffizienzpolitik bei?
Dr. Dütschke: Ich denke, Suffizienz unterscheidet sich hier nicht von anderen Bereichen. Ein umfassender gesellschaftlicher Wandel wird nur gelingen, wenn er von und mit der Gesellschaft entwickelt wird. Das geschieht über bestehende demokratische Prozesse, aber auch über neue Formate.
Dr. Preuß: Auch hier gilt es natürlich wieder alle Bevölkerungsgruppen abzuholen und niemanden außen vorzulassen.
DUS: FULFILL wird länderübergreifend umgesetzt. Können Sie länderspezifische Unterschiede ausmachen? Und welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus im Hinblick auf die Frage, auf welcher föderalen Ebene Suffizienzpolitik ansetzen sollte?
Dr. Dütschke: Was die individuellen Lebensstile angeht, finden wir interessanterweise einige ähnliche Muster über die Länder hinweg, etwa was den Zusammenhang zwischen Einkommen und Ressourcenverbrauch angeht. Die strukturellen Faktoren und die politischen Rahmenbedingungen sind jedoch unterschiedlich. Hier sind wir aber noch mitten in der Analyse.
DUS: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: „Damit gutes Leben einfacher wird“, heißt ein bekanntes Buch zum Thema Suffizienz von Uwe Schneidewind. Welchen Ratschlag würden Sie unseren Leser*innen geben, um ihr Leben suffizienter zu gestalten?
Dr. Preuß: Wirklich zu hinterfragen, ob ich das brauche und warum – egal, ob es um das neue Oberteil, den Flug nach Mallorca, den Umzug in die sehr viel größere Wohnung oder im Supermarkt um die Avocado aus Mexiko geht. Oft sind uns unsere Bedürfnisse gar nicht richtig bewusst. Was wir wirklich brauchen, wird manchmal deutlich, wenn jede*r reflektiert, was er oder sie auf einer einsamen Insel definitiv für sich brauchen würde. Für manche mag es das Make-up sein, für andere vielleicht ein gutes Buch oder Musik und für wieder andere gar nichts – für viele vermutlich das Handy, um mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben. Darüber hinaus ist auch der suffiziente Umgang mit Zeit etwas, das mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ich persönlich – ohne es mit wissenschaftlichen Artikeln untermauern zu können – kann einen Trend erkennen zu einer Reduktion der Arbeitszeit und dem Wunsch nach gemeinsamer Zeit, beispielsweise das gemeinsame Arbeiten im Garten oder ein gemeinsamer Zoobesuch als Geburtstagsgeschenk – ganz weg von materiellen Dingen.
ÜBER DIE INTERVIEWPARTNERINNEN
Dr. Elisabeth Dütschke ist Diplom-Psychologin und forscht seit fast 15 Jahren am Fraunhofer ISI in Karlsruhe zur gesellschaftlichen Perspektive auf die Energiewende. Sie koordiniert das interdisziplinäre Geschäftsfeld Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems.
Dr. Sabine Preuß hat in Psychologie promoviert und erforscht seit 2019 am Fraunhofer ISI den „Faktor Mensch“ in der Energiewende. Sie untersucht Verhaltens- und Einstellungsänderungen sowie die Akzeptanz von Technologien und Politiken – mit einem besonderen Fokus auf Energiegerechtigkeit und diversen Bevölkerungsgruppen.
Zusammen leiten Dr. Dütschke und Dr. Preuß das Forschungsprojekt FULFILL.