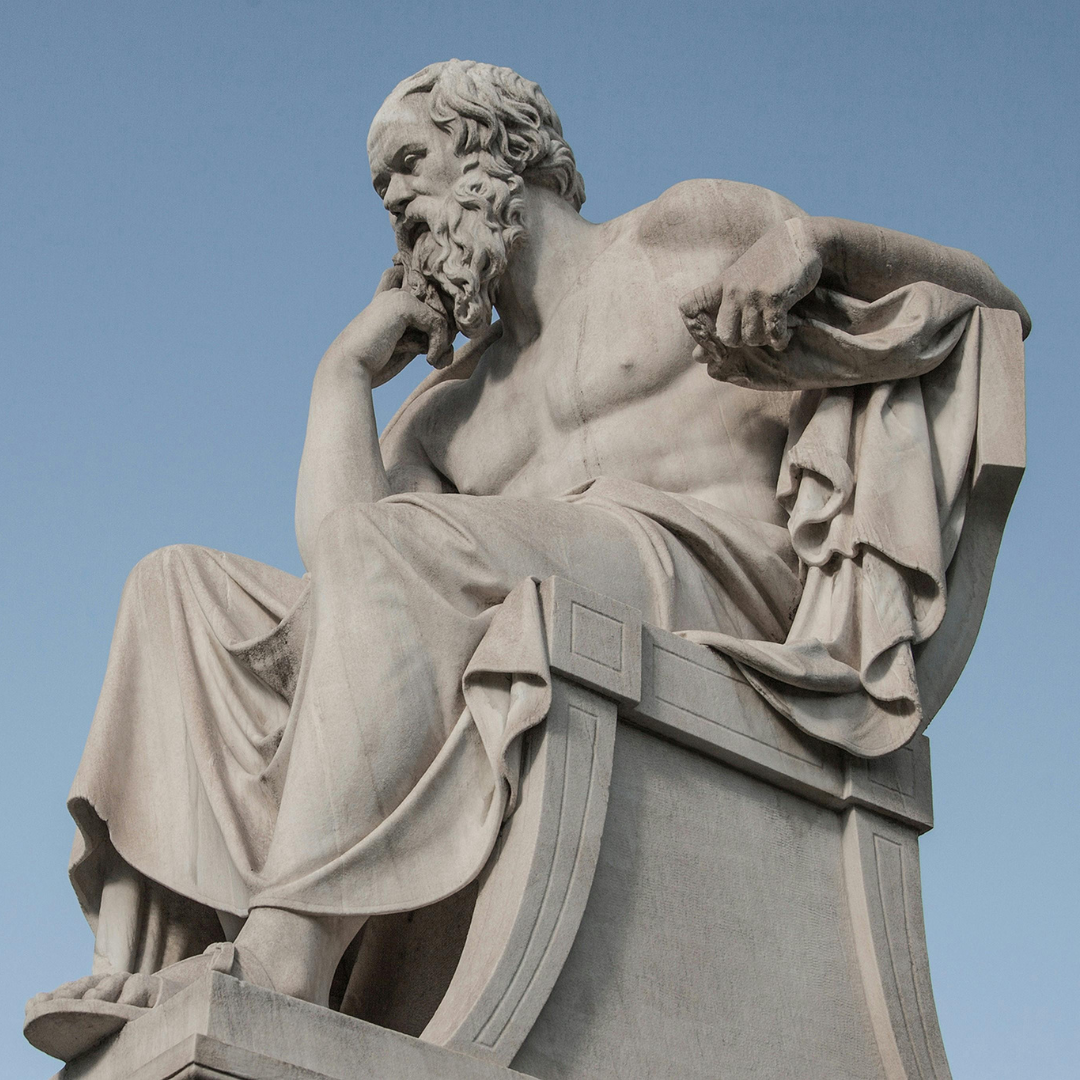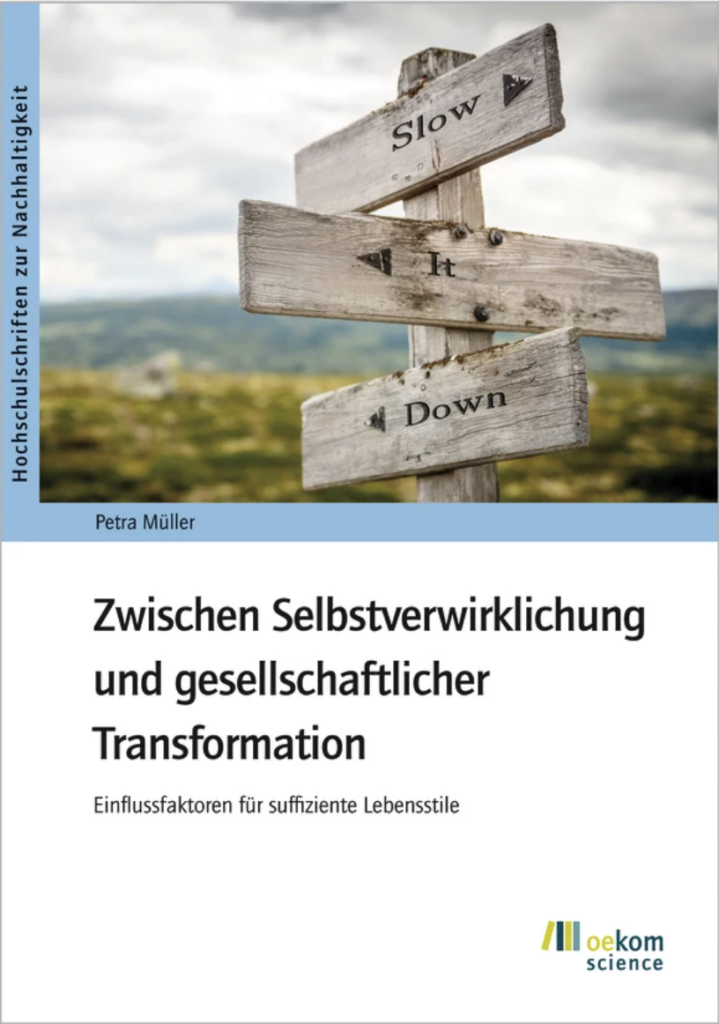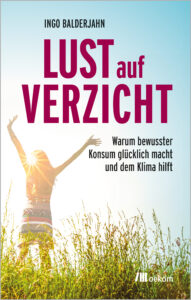Nachhaltigkeit steht bei vielen Menschen hoch im Kurs. Wie man sich entsprechend verhält und illustrierende alltagsnahe Beispiele wurden bis vor einigen Jahren zumeist in Form von Broschüren und Ratgebern verbreitet. Im Zeitalter der Digitalisierung tritt an diese Stelle verstärkt ein digitales Angebot mit Informationsportalen und zunehmend auch interaktiv bzw. spielerisch gestalteten Apps.
Ein großer Vorteil ist dabei, dass diese Anwendungen häufig die Eingabe eigener Daten erlauben. Dies ermöglicht es Nutzer*innen, binnen von Minuten einen quantifizierten Eindruck ihrer persönlichen Lebenssituation zu erhalten. Das vermutlich bekannteste Beispiel für eine derartige Anwendung ist der CO₂-Rechner des Umweltbundesamtes, mit dem Nutzer*innen ihren CO₂-Fußabdruck bestimmen und so bspw. die Klimawirkung ihrer Flugreise ermitteln können.
In diesem Beitrag soll ein anderes Beispiel im Fokus stehen: der SuffizienzCheck. Er wurde vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts „SuPraStadt II – Lebensqualität, Teilhabe und Ressourcenschonung durch soziale Diffusion von Suffizienzpraktiken in Stadtquartieren” entwickelt.
Ernährung, Reisen, Wohnen
Das Besondere an der Anwendung ist der Fokus auf ressourcenschonende Lebensstile. Die Anwendung erlaubt es User*innen anonym, die eigenen Mobilitätsmuster, die aktuelle Wohnsituation und die persönliche Ernährung hinsichtlich des Grads an Suffizienz binnen weniger Minuten abzuschätzen. Dazu führt das Programm den oder die Anwender*in durch einen themenspezifischen Fragebogen, um die relevanten Eckpunkte zu ermitteln. So werden bspw. zur Ermittlung des Nutzerprofils bei der Wohnsituation die Eigentumsverhältnisse (Miete, Eigentum), die Quadratmeter, Zimmer- und Personenanzahl des Haushalts abgefragt. Auf Basis dessen wird sodann eine relative Bewertung im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt generiert und darüber hinaus ein anzustrebender Optimalwert als Richtwert unter Berücksichtigung globaler Gerechtigkeitserwägungen generiert.
Im Bereich „Reisen” können die ökologischen Auswirkungen privater und dienstlich bedingter Mobilität ermittelt werden. Dabei verdeutlicht die Anwendung per Klick grafisch anschaulich die unterschiedlichen Treibhausgasemissionen und den relativen Anteil von Reise- und Aufenthaltszeit. Letzteres wird dabei der allgemeinen Grundeinstellung zuwiderlaufend nicht zwingend negativ verstanden, sondern als ein Indikator der Entschleunigung interpretiert. So kann durch die Brille der Suffizienz betrachtet, ein längerer Reiseweg bereits ungeachtet der ökologischen Vorteile erstrebenswert sein, wenn er positive Erlebnisse, Erholung oder Spaß fördert. Das altbekannte Sprichwort „Der Weg ist das Ziel” erscheint hier in neuem Gewand.
In der dritten Kategorie steht die persönliche Ernährung im Vordergrund. Nutzer*innen können aus einer Vielzahl von Menükomponenten repräsentative Mahlzeiten bestehend aus einer Hauptkomponente, zwei Beilagen und einer Nachspeise kreieren. Optional können zudem bereits praktizierte Maßnahmen ausgewählt werden, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken, wie bspw. die Beteiligung an lokalen Foodsharingprojekten. Anschließend erhalten die Nutzer*innen Informationen hinsichtlich der damit einhergehenden Treibhausgasemissionen.
Ein alltagsnaher Begleiter
Eine ganze Reihe von Dingen macht den SuffizienzCheck zu einer rundum gelungenen Anwendung.
- Visualisierte Soll-Ist-Vergleiche
Die Anwendung bietet für alle Bereiche grafische Elemente, die die ermittelten Werte veranschaulichen, sei es die relative Größe der eigenen Wohnung zum bundesweiten Durchschnitt oder die Klimarelevanz unterschiedlicher Nahrungsmittel.
- Konkrete Tipps
Anders als andere Anwendungen endet der Prozess nicht bei der quantitativen Darstellung. Ergänzend erfolgt eine qualitative Einordnung, die das Konsummuster einordnet und alltagsnahe Tipps gibt, wie das eigene Verhalten noch ressourcenschonender gestaltet werden könnte.
- Vermittlung von Hintergrundwissen
An vielen Stellen erfahren User*innen mit kompakten Informationsblöcken mehr zum Thema Suffizienz allgemein bzw. bezogen auf die Bereiche Ernährung, Reisen und Wohnen. Dabei ist der Tenor betont sachlich und informativ. Für Neugierige bieten weiterführende Links die Möglichkeit, tiefer in die Materie einzusteigen.
Abschließend bleibt zu sagen: Checken Sie hier Ihre Suffizienz.