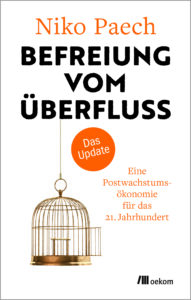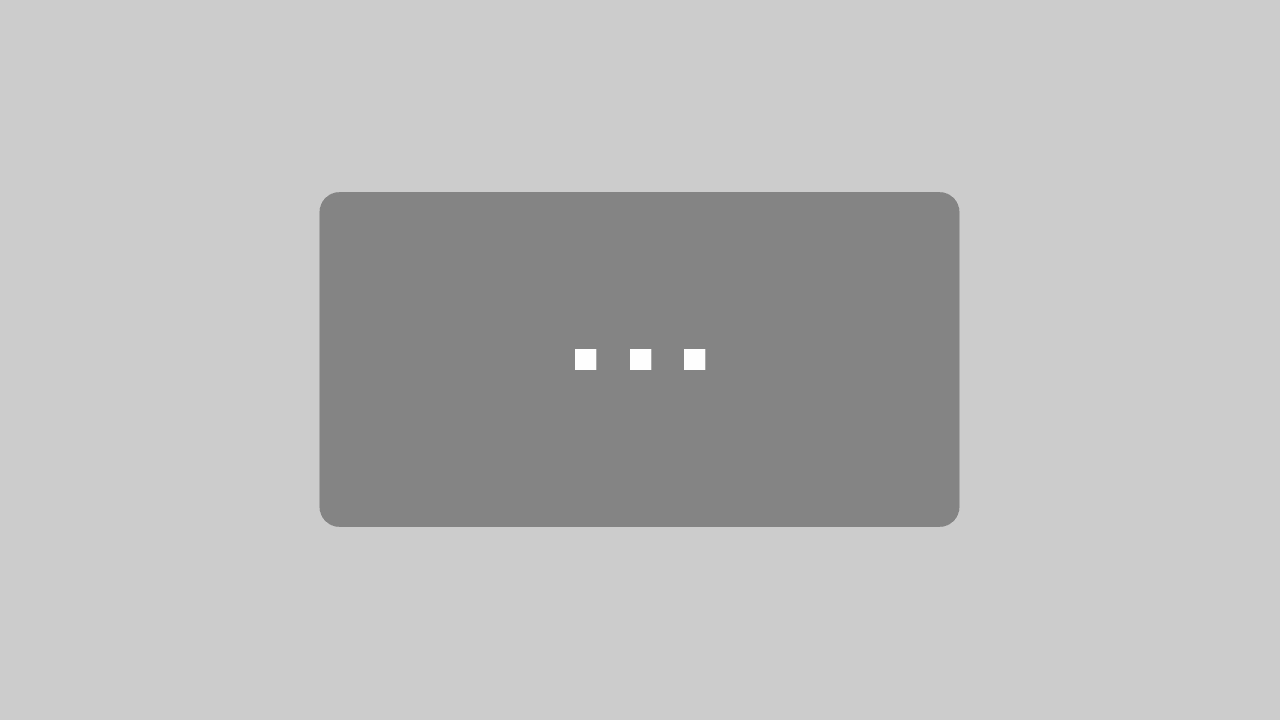„Befreiung vom Überfluss“ ist der Titel eines bekannten Buchs des Wissenschaftlers Niko Paech, das unlängst in einer überarbeiteten Fassung erschienen ist. Darin skizziert der Autor Konturen einer Postwachstumsökonomie. Dazu zeigt er schonungslos auf, welche Konsequenzen unser ressourcenintensiver Konsumhunger für die Lebensgrundlagen des Menschen haben und begründet die Notwendigkeit einer grundlegenden Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Suffizienz spielt dabei eine wesentliche Rolle. Während jedoch Effizienz und Konsistenz häufig systemisch gedacht werden, bspw. wenn es um die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft oder die Transformation des Energiesystems geht, dominierte bei Suffizienz lange Zeit eine individuelle Perspektive. Ratgeber gaben Hinweise für die Veränderung des eigenen Lebensstils und lieferten Anregungen, wie der persönliche Alltag ressourcenschonender gestaltet werden kann, bspw. indem auf Flugreisen verzichtet wird, der Fleischkonsum reduziert wird, eine Substitution des Autos durch das Fahrrad bzw. den ÖPNV erfolgt oder die Raumtemperatur im Winter abgesenkt wird.
Verhaltensänderungen erleichtern
Seltener standen bisher in der öffentlichen Wahrnehmung Push- und Pull-Faktoren im Fokus, die suffizientes Verhalten erleichtern und Anreize bieten bzw. nicht-suffizientes Verhalten sanktionieren können. Dabei betonen Vorhaben wie das Projekt „Gute Beispiele für eine gelingende Transformation“ des Wuppertal Instituts oder das Vorhaben „FULFILL“ des Fraunhofer ISI, dass entsprechende Anreize mittels einer gezielten Suffizienzpolitik die Veränderungsbereitschaft von Menschen begünstigen können.
Rolle von Unternehmen
Es liegt auf der Hand, dass bei diesem Thema Unternehmen unweigerlich eine Schlüsselrolle spielen. Dies verdeutlicht die Lektüre der eingangs genannten Publikation „Befreiung vom Überfluss“, in der eine Postwachstumsalternative in Abgrenzung zum vorherrschenden Green Growth Paradigma entwickelt wird, eindrücklich. Damit Unternehmen diesem Anspruch jedoch gerecht werden können und ihren Beitrag zum Gemeinwohl und zur nachhaltigen Transformation leisten können, wird es merklicher Veränderungen in den Wertschöpfungsprozessen bedürfen, die eine Abkehr von der vorherrschenden Shareholderorientierung implizieren. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie bietet hierfür wertvolle Ansatzpunkte, indem es Werte wie Menschenwürde, ökologische Verantwortung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz betont.
Konsument*innen unterstützen
Fokussiert man sich an dieser Stelle auf die Ausgestaltung von Produkten und Dienstleistungen, verdeutlichen eine Reihe von EU-Maßnahmen wie das Recht auf Reparatur und die Ökodesign-Richtlinie in welche Richtung die Reise für Unternehmen zukünftig gehen sollte. Es geht darum, den maßvollen Konsum der Bürger*innen mittels geeigneter Produkte und Dienstleistungen aktiv zu unterstützen.
Anstelle auf kurzlebig gestaltete Wegwerfgüter, geplante Obsoleszenz oder unter prekären Arbeitsbedingungen hergestellte Fast Fashion Produkte zu setzen, sollten Merkmale wie Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten und zugehörige Serviceleistungen in den Fokus rücken. Der ab 2027 in der EU verbindliche digitale Produktpass ist daher ein wichtiger Schritt, um Konsument*innen einen umfassenden Einblick in den Produktlebenszyklus von Produkten zu geben insb. auch hinsichtlich der Reparierbarkeit und verfügbarer Ersatzeile.
Erste Schritte von Unternehmen
Stellenweise finden sich in der Praxis bereits gute Beispiele, die als Anregung dienen können. Einige Hersteller robuster Outdoor-Ausrüstung bieten bspw. lebenslange Garantien und kostenlose Reparaturservices an. Auch kleinere Textilhersteller haben die Möglichkeit geschaffen, verkaufe Produkte „aufhübschen“ zu lassen.
Eine Reihe von Unternehmen haben insb. im Mobilitätsbereich Geschäftsmodelle aufgebaut, die dem Ansatz der Sharing-Economy folgen. Im Segment elektronischer Konsumgüter finden sich diesbezüglich vermehrt Verleihsysteme bspw. für Werkzeuge und Maschinen. Gleiches gilt für die Möglichkeit spezielles Equipment für besondere und seltene Anlässe wie bspw. Lichttechnik oder Mobiliar auszuleihen.
Zunehmend gewinnen auch zirkuläre Modelle wie Produktrotation oder Umtauschsysteme an Bedeutung. Gerade im Bereich von Kindermode oder Babybedarf bieten vermehrt Anbieter die Möglichkeit, Produkte nach einer bestimmten Nutzungszeit zurückzugeben oder gegen andere auszutauschen. So bleiben Materialien im Kreislauf, und der Bedarf an Neuware sinkt. In dieser Hinsicht sind auch modular gestaltete Produkte positiv zu sehen. Jedenfalls, wenn sie mit dem Gedanken konzipiert werden, eine langfristige Nutzungsdauer zu erreichen, indem das Produkt an sich wechselnde Lebensumstände angepasst werden kann und nicht modische Aspekte im Vordergrund stehen.
Kräfte bündeln – suffizienzkompatible Anreize setzen
Wenn Suffizienzstrategien einen größeren Stellenwert bei der nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft spielen sollen, braucht es dafür stärker als bislang ein akteursübergreifendes Bekenntnis und sich ergänzende Maßnahmen. Bürger*innen können in ihrer Rolle als Konsumenten zwar gezielte Kauf- und Verzichtsentscheidungen treffen, jedoch nur, wenn das Angebot und die Rahmenbedingungen vorhanden sind. Hier sind Unternehmen und Politik gefragt, suffizientes Verhalten mittels entsprechender Serviceangebote bzw. politischer Weichenstellungen erleichtern. Wie Letzteres in der Praxis aussehen kann, zeigt das Bundesland Thüringen. Hier wird seit 2021 jährlich ein Reparaturbonus für Elektrogeräte in Höhe von 50 Prozent gewährt. Die Förderung ist auf 100 Euro pro Thüringer*in gedeckelt. Seit Einführung der Förderung wurden bereits über 30.000 Anträge bewilligt. Eine Untersuchung des Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) zeigt dabei auf der einen Seite positive Effekte für die regionale Wertschöpfung, da Reparaturen häufig von Fachhändlern und Werkstätten durchgeführt werden. Auf der anderen Seite stehen ökologische Gewinne Dank des Reparaturbonus in Form von rund 3.000 Tonnen eingesparten CO2 Emissionen und circa 400 Tonnen Elektroschrott.
Trotz der positiven Erfahrungen in Thüringen sind vergleichbare Angebote bislang nur in Sachsen und Berlin zu finden und nicht bundesweit. Es ist dringend an der Zeit, dies zu ändern.