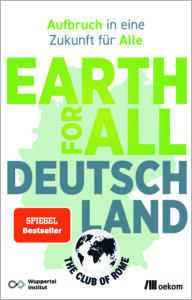Nachdem Niko Paech bereits 2012 das Buch „Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ veröffentlichte, hat er nun 13 Jahre später eine aktualisierte Fassung seines Werkes erstellt, die aktueller kaum sein könnte. In dieser setzt sich der bekannte Wachstumskritiker – um es mit den Worten Winfried Kretschmers auf dem Buchdeckel zu sagen „pointiert, scharfzüngig, aber immer präzise argumentierend“ mit dem weiterhin vorherrschenden ressourcenintensiven Wachstumsdogma auseinander.
Dabei vermag er eine zunehmende Parallelität zweier Entwicklungen zu erkennen: Einerseits schreiten die multiplen Krisen unweigerlich voran und die Ökosphäre stehe mehr denn je unter Druck. Zugleich erfahre das Konzept der Postwachstumsökonomie vermehrt Aufmerksamkeit – nicht nur akademisch bzw. theoretisch, sondern auch ganz konkret in Form sich Gehör verschaffender Protestbewegungen wie Fridays for Future, Ende Gelände oder Extinction Rebellion.
„Kein weiter so“
Vor diesem Hintergrund benennt der Autor direkt das Ziel der überarbeiteten Fassung des Buchs: Es habe den bescheidenen Zweck, den Abschied von einem Wohlstandsmodell zu erleichtern, das aufgrund seiner chronischen Wachstumsabhängigkeit unrettbar geworden ist (S. 17).
Um dies zu zeigen, stellt er sodann drei Thesen auf, denen er sich im Folgenden widmet: Erstens, der nur durch permanentes Wachstum aufrecht zu erhaltende Wohlstand gehe nicht zufällig mit einer umfassenden ökologischen Plünderung einher. In den ersten drei Kapiteln führt er dazu aus, dass die Menschen vielmehr einer umfangreichen Selbsttäuschung unterlägen, die dazu führe, dass sie in dreifacher Weise über ihre Verhältnisse lebten. Sie eignen sich „Dinge an, die in keiner äquivalenten Beziehung zu ihrer eigenen Leistungsfähigkeit stehen. Sie entgrenzen ihren Bedarf erstens von den gegenwärtigen Möglichkeiten, zweitens von den eigenen körperlichen Fähigkeiten und drittens von den lokal oder regional vorhandenen Ressourcen (S. 19).”
Unzähmbarer Hunger
Dazu zeigt er anschaulich, wie moderne Konsumgesellschaften systematisch über ihre Verhältnisse leben, absurde Konsumbedürfnisse entwickeln und dabei die ökologischen Grundlagen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen untergraben. Er setzt sich intensiv mit der ausgeprägten gesellschaftlichen und politischen Bereitschaft auseinander, gegenwärtige Ansprüche mittels Verschuldung zu befriedigen und begründet diese. Die Verschuldung verstärke jedoch den Wachstumszwang, da nur so die Schulden zukünftig getilgt werden können. Dabei verdeutlicht der Autor, dass zweifelhafte politische Motivationen und Weichenstellungen mit der Folge ökologisch katastrophaler Steuer- und Subventionsanreize wesentliche Treiber dieser Entwicklungen sind.
Im Folgenden setzt er sich vor dem Hintergrund des schlechten Zustands der Ökosphäre kritisch mit zentralen Elementen orthodoxer Wirtschaftstheorie auseinander – seien es postulierte Mehrwerte infolge technischer Innovationen, der Digitalisierung oder schlicht der globalen Arbeitsteilung. Dabei arbeitet er auch heraus, dass ein falsch verstandenes Fortschrittsverständnis das Aufkommen einer „Bequemokratie” (S. 40) begünstigt, in dessen Folge es zu erheblichen Kompetenzverlusten der Menschen kommt (Verlust handwerklichen Geschicks, zunehmender Bewegungsmangel etc.). Verstärkt werde dies noch durch die immer größere Bedeutung sogenannter „Energiesklaven“ (S. 40). Gemeint sind damit Maschinen und elektronische Geräte wie Smartphones oder Laubsauger, die Menschen körperliche Arbeit abnehmen, aber zugleich dazu beitragen, manuelle Fähigkeiten verkümmern zu lassen sowie einen enormen Energieverbrauch nach sich ziehen. Dabei betont der Autor, dass der immense Energie- und Ressourcenhunger längst nicht nur auf die Oberschicht begrenzt bleibt, sondern breite Teile des Mittelstandes betrifft, wie die anhaltend ausgeprägte Flugbereitschaft und das Streben nach immer weiterer vermeintlicher Wohlstandsmehrung eindrücklich zeigen. Die gewachsenen Konsummöglichkeiten entstammen dabei aus Sicht von Paech nicht einer größeren Schaffenskraft der Menschen, sondern basieren auf einer leistungslosen Aneignung. Im Ergebnis fordert er daher in Tradition von Leopold Kohr und Ernst Friedrich Schumacher eine Rückkehr auf das menschliche Maß, also eine Einhegung körperlicher, räumlicher und zeitlicher Entgrenzung (S. 52). Er entwickelt sodann Ansätze, wie eine derartige stärker auf Selbstversorgung ausgerichtete Gesellschaft aussehen könnte und grenzt sie zum vorherrschenden System der Fremdversorgung ab.
Das Märchen vom grünen Wachstum
Das vierte Kapitel ist der Erörterung seiner zweiten These gewidmet. Er setzt sich dazu kritisch mit den Annahmen des green growth auseinander und zeigt, dass technische Innovationen nicht dazu im Stande sind, Wachstum und Umweltschäden dauerhaft voneinander zu entkoppeln. Aus einer längeren Darstellung des Rebound-Effektes leitet er schließlich ab, dass es nicht um die Gestaltung nachhaltiger Produkte oder Technologien gehe. Nachhaltigkeit könne sich lediglich in Form veränderter Lebensstile ausdrücken. Zugleich sollten die Auswirkungen des subjektiven Handelns nur in ihrer Summe in Form persönlicher Ökobilanzen beleuchtet werden. Hier offenbart sich jedoch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: So betrage die aktuelle durchschnittliche CO₂-Bilanz eines Bundesbürgers schätzungsweise rund 11 Tonnen pro Jahr und überschreitet mithin den mit dem globalen Klimaschutz vereinbaren Wert um ein Vielfaches. Um die Gesamtheit der ökologischen Auswirkungen systematisch zu erfassen, plädiert Paech daher für die Verwendung eines ökobilanziellen Ansatzes, trotz bestehender methodischer Herausforderungen und Schwächen (S. 88).
Die Alternative
Im Anschluss an eine Betrachtung der vorherrschenden strukturellen und kulturellen Wachstumszwänge, -imperative und -treiber (Kapitel 5) widmet sich der Autor schließlich im sechsten Kapitel seiner dritten These. Diese sieht eine radikale Abkehr vom bisherigen ökonomischen Handeln vor. Eine Postwachstumsökonomie würde zwar eine drastische Reduktion der industriellen Produktion und des Technologieeinsatzes bedeuten, hätte jedoch zwei Vorzüge: Sie würde im Sinne der Resilienz die ökonomische Stabilität der Versorgung stärken und zugleich eine höhere Lebensqualität eröffnen (vgl. S. 20).
Eine wichtige Rolle spielen dabei die Prinzipien der Subsistenz, Suffizienz und Reduktion. Die Postwachstumsökonomie zeichne sich durch regionale, arbeitsintensive und kapitalarme Produktionsweisen aus, die lokale Wertschöpfung ermöglichen und zugleich die Abhängigkeit von globalisierten Lieferketten verringern. Ziel müsse es sein, eine neue Form der Lebensqualität zu implementieren, die auf Zeit, Gemeinschaft und Selbstbestimmung basiere anstatt auf Konsum und Status. Dies solle u. a. durch die Verkürzung der Arbeitszeit auf 20 Stunden pro Woche, der Wiederaneignung von Reparatur- und Selbstversorgungskompetenzen, der vermehrt gemeinschaftlichen Nutzung von Gütern, der Entwicklung langlebiger Produkte sowie der Einführung regionaler Komplementärwährungen möglich werden. Auch in einem postwachstumsökonomischen Gesellschaftszustand würde es laut des Autors zwar Unternehmen geben, jedoch in deutlich veränderter Form.
Fazit
Trotz der umfassend vorgeschlagenen Alternative bleibt das Problem der realen Umsetzbarkeit bestehen. Paech selbst weiß um diese Problematik und betont, dass viele seiner Positionen aktuell in der Gesellschaft nicht mehrheitsfähig sind. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden ökologischen Herausforderungen – seien es Artensterben oder der fortschreitende Klimawandel – ist vermutlich gerade deswegen seine radikale Sicht lesenswerter denn je. Denn es braucht rasch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft grundlegende Veränderungen, wenn wir eine Überlastung der Erdsystemprozesse mit fatalen Folgen für die Menschheit verhindern wollen. Die Lektüre von „Befreiung vom Überfluss” öffnet nicht nur die Augen, sondern zeigt zugleich einen alternativen Pfad auf, dessen Beschreitung jedoch viel Mut und Veränderungsbereitschaft verlangt – von jedem Einzelnen.
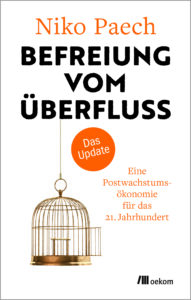
Buchinformationen
Autor: Niko Paech
Titel: Befreiung vom Überfluss – das Update. Eine Postwachstumsökonomie für das 21. Jahrhundert.
Verlag: oekom
ISBN: 978-3-98726-139-8
Hardcover, 144 Seiten
Erscheinungstermin: 03.04.2025