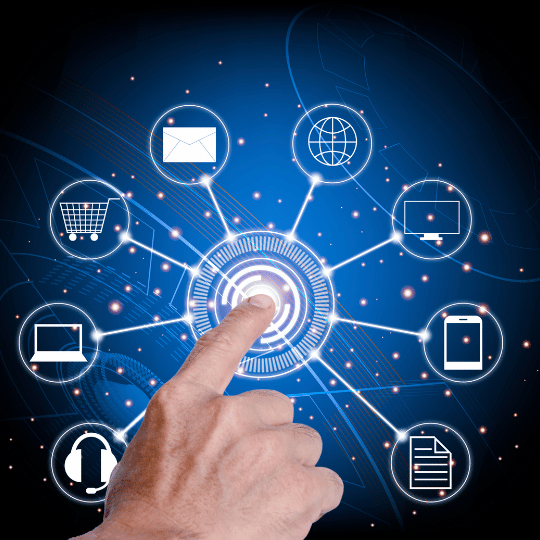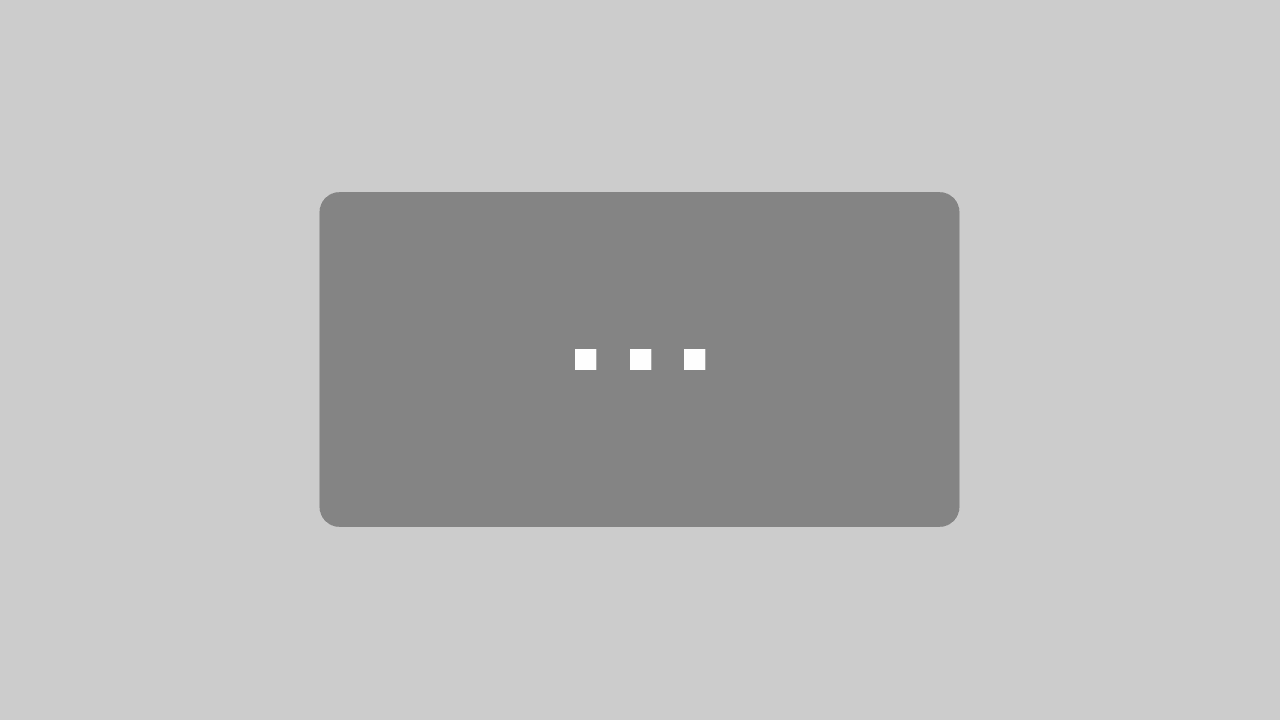Die Fashion Weeks dieser Erde zeigen uns regelmäßig, welcher Schnitt, welche Farbe und welche Kombinationen von Kleidungsstücken gerade angesagt sind. Mode ist Ausdruck eines bestimmten Zeitgeistes, sie zeichnet sich durch Aktualität, Wechselhaftigkeit und Schnelllebigkeit aus. Und genau hier liegt das Problem. Die Textilindustrie hat einen bemerkenswert großen ökologischen Fußabdruck, was uns zur Frage bringt: Geht Mode auch nachhaltig? NEIN. Nachhaltigkeit ist kein Attribut, sondern ein Nutzungskonzept. Aber schauen wir genauer hin:

Fast Fashion vs. Slow Fashion
Schnelllebigkeit und Aktualität definieren den sogenannten „Fast Fashion“-Trend. Damit sind die immer kürzer werdenden Abstände zwischen neuen Kollektionen, die sich an den aktuellsten Modetrends orientieren, gemeint. Durch Massenproduktion und das Outsourcen in Billiglohnländer kann diese Form von Mode immer schneller und günstiger produziert werden. Aufgrund der niedrigen Preise und der meist minderwertigen Qualität führt Fast Fashion zu einer Wegwerfgesellschaft und damit zu massiven Umweltschäden. Ist das nachhaltig? Bestimmt nicht.
Wir müssen weg von Mode und hin zur nachhaltigen Kleidung
Es gibt eine Gegenbewegung zu Fast Fashion: Sie wird als „Slow Fashion“, „Green Fashion“ oder auch „Eco Fashion“ bezeichnet – und setzt auf das Konzept Nachhaltigkeit. Sie zeichnet sich neben einer nachhaltigen und fairen Produktion vor allem durch ihre Langlebigkeit aus. Diese Art von Kleidung soll aus qualitativ hochwertigeren Materialien bestehen und folgt weniger den aktuellen Trends, sondern setzt auf ein klassisches und zeitloses Design. Es setzt auf Langlebigkeit.
Aber Vorsicht: Akteure der Modebranche stellen sich gerne als besonders nachhaltig dar. Influencer*innen, die vegane Marken empfehlen und Modehäuser, die recycelte Ware anbieten: Klingt fortschrittlich, aber ist es das auch? In vielen Fällen ist es schlicht Greenwashing. Anders als oft suggeriert, wird bzw. nicht einmal ein Prozent der getragenen Kleidung zu neuer „Mode“ recycelt.
Kriterien
Natürlich muss ab und zu trotzdem etwas „Neues“ her. Dabei ist es gar nicht so leicht zu erkennen, ob ein Kleidungsstück nachhaltig produziert wurde oder ob es sich um Greenwashing handelt. Im Quellenverzeichnis findet ihr eine Liste mit Öko-Textil-Siegeln, die umweltfreundlich hergestellte Kleidung kennzeichnet.
1. Materialien aus biologischen Rohstoffen
Es ist wichtig, dass bei der Textilherstellung nur Materialien aus umweltverträglichen und zu 100 % biologisch abbaubaren Rohstoffen verwendet werden. Beim Anbau wird auf den Einsatz von Pestiziden, chemischen Düngemitteln, Insektiziden und anderen schädlichen Substanzen verzichtet. So gelangen weniger Chemikalien ins Grundwasser und in die Böden, dem Insektensterben wird entgegengewirkt und die Schadstoffbelastung der Menschen vor Ort wird erheblich reduziert.
2. Ressourcenschonende Produktion
Neben einem möglichst geringen Wasser- und Energieverbrauch ist die Verwendung schnell nachwachsender Rohstoffe wie z. B. Bambus ein weiteres Kriterium. Lieferwege sollten so kurz wie möglich und die gesamte Lieferkette möglichst in derselben Region verortet sein.
3. Recycling & Upcycling
Ein weiterer essenzieller Teil grüner Mode ist das Recyceln und Upcyclen von verschiedenen Materialien zur Herstellung neuer Kleidungsstücke. Mittlerweile werden auch Abfallprodukte, wie z. B. Schnittreste aus der Forstwirtschaft, Plastikflaschen oder Fischernetze immer häufiger genutzt, um daraus neue Stoffe herzustellen. Der Ressourceneinsatz wird auf ein Minimum reduziert, sodass ebenfalls weniger Müll entsteht.
4. Soziale und faire Produktionsbedingungen/ Arbeitsbedingungen
Green Fashion muss immer gerechte Bezahlung, gute und sichere Arbeitsbedingungen bedeuten. Sie darf nicht aus Kinderarbeit entstehen und Rohstoffpreise entlang der gesamten Produktionskette müssen angemessen bezahlt werden.
Aber wir müssen nicht gänzlich auf Abwechslung im Kleiderschrank verzichten! Es gibt viele Alternativen zum Neukauf: wie z. B. Second Hand, Kleidertauschpartys, Flohmärkte oder Kleidervermietung. In unserer Checkliste haben wir ein paar Tipps zusammengestellt:

Was Verbraucher*innen tun können
Uns als Verbraucher*innen kommt eine entscheiden Rolle zu. Es ist wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Kleidung und Konsum grundsätzlich hinterfragen und unser Bewusstsein hin zu einem suffizienten Modekonsum umstellen. Dinge sollten nur dann gekauft werden, wenn sie wirklich benötigt werden und nicht nur zur Freizeitbeschäftigung oder Belohnung. Außerdem müssen wir die Lebensspanne unserer Kleidungsstücke verlängern, um der Wegwerfmentalität und dem dadurch entstehenden Müll entgegenzuwirken. Suffizienz und Degrowth sind dabei wichtige Stichwörter.
Quellen:
- Inka Reichert (2019): So macht unsere Kleidung die Umwelt kaputt. Online unter URL: https://www.quarks.de/umwelt/kleidung-so-macht-sie-unsere-umwelt-kaputt/ [Abruf: 12.07.2022].
- Michael Rebmann (2012): Wie nachhaltig kann Mode sein? Online unter URL: https://diefarbedesgeldes.de/artikel/2012/wie-nachhaltig-kann-mode-sein [Abruf: 01.07.2022].
- Alessa Faiss (2018): Vereinbarkeit von Mode und Nachhaltigkeit. Welche Barrieren hindern Konsumenten am nachhaltigen Modekonsum? Online unter URL: https://www.grin.com/document/449919[Abruf: 05.07.2022].
- Loveco (2021): Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Mode? Online unter URL: https://loveco-shop.de/magazin/nachhaltigkeit-mode/#Definition [Abruf: 07.07.2022].
- Annika Sinnen (2015): Die Zukunft der Textilien Produktion-Trends einer nachhaltigen Entwicklung am Praxisbeispiel des „Modelabels Privatsachen“ online unter URL: https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/6434/file/BACHELORARBEIT+Nachhaltige+Mode+2015.pdf [Abruf: 11.07.2022].
- Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute: online unter URL: https://www.dwds.de/wb/Mode [Abruf: 01.07.2022].
- Duden: online unter URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Mode_Kleidung_Stil_Geschmack [Abruf: 01.07.2022].
- Carolin Wahnbaeck (2019): Schadstoffe auf der Haut: Diese Siegel garantieren giftfreie Kleidung online unter URL: https://utopia.de/ratgeber/siegel-kleidung-textilien-ohne-gift-textilratgeber-greenpeace/ [Abruf: 11.07.2022].