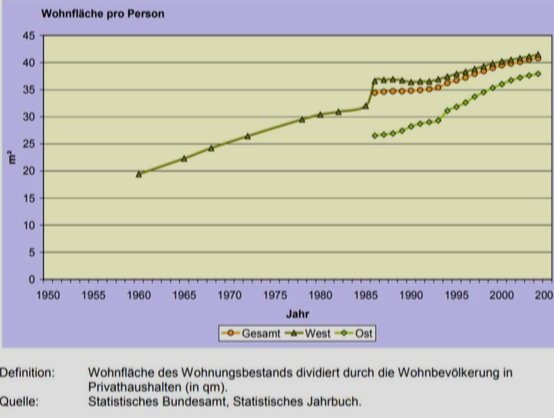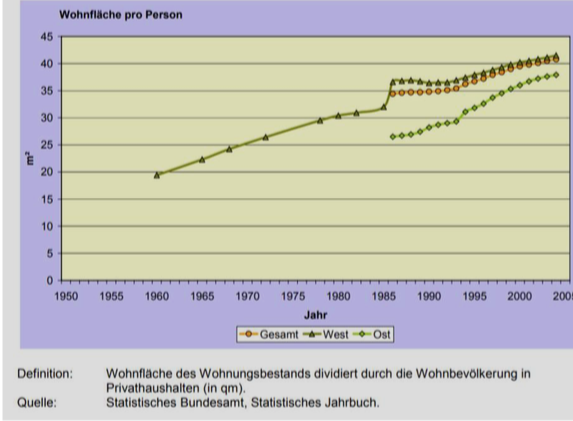In Zürich ist der Wunsch nach einer nachhaltigeren Gesellschaft in der Gemeindeordnung verankert. Durch unterschiedliche Maßnahmen und Anreize der Stadtverwaltung, soll der Energieverbrauch der Bevölkerung verringert werden. Die Lebensqualität hingegen soll darunter nicht leiden. Tina Billeter erklärt wie dieses Modell funktioniert und was sich in Zürich dadurch verändert hat.
Der Weg zu einer suffizienten Gesellschaft
Deutsche Umwelstiftung: Sie wenden in Zürich das Modell 2000-Watt-Gesellschaft an. Um was genau handelt es sich und was sind die Ziele?
Tina Billeter: Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein energie- und klimapolitisches Ziel, um eine messbar nachhaltige und umweltfreundliche Gesellschaft zu werden. Dieses Ziel wurde bereits 2008 aufgrund einer demokratischen Volksabstimmung in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich verankert. Konkret bedeutet es, dass der Primärenergiekonsum auf 2000 Watt pro Person und der Treibhausgasausstoss bis 2050 auf 1 Tonne pro Person und Jahr gesenkt wird. Energieeffizienz, erneuerbare Energien und die nachhaltige Ernährung werden gefördert; auf Atomkraft verzichtet.
Deutsche Umweltstiftung: In dem Ergebnisbericht „Suffizienz: Ein handlungsleitendes Prinzip zur Erreichung der 2000-Watt-Gesellschaft“ der Arbeitsgruppe Suffizienz, sprechen Sie darüber, dass Suffizienz neben Effizienz und Konsistenz einen erheblichen Einfluss auf die Realisierung der 2000-Watt-Gesellschaft hat. Wieso ist dies der Fall?
Tina Billeter: Im Masterplan Energie sind die drei handlungsleitenden Prinzipien festgehalten: Suffizienz, Effizienz, Konsistenz. Diese beruhen auf Analysen und Szenarien, die u.a. in der Roadmap 2000-Watt-Gesellschaft festgehalten sind: Sie zeigten, dass alleine mittels der zwei Stellschrauben Effizienz und Konsistenz die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft nicht erreicht werden können. Deshalb müssen wir verstärkt auf die Genügsamkeit setzen. Ohne Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs können wir den Primärenergiekonsum nicht auf 2000 Watt reduzieren und die Treibhausgasemissionen nicht in den Griff bekommen.
Deutsche Umweltstiftung: Wenn wir von Suffizienz sprechen, ist oftmals Verzicht gemeint. Wie kann der Begriff Verzicht, der in der Regel negative Konnotationen hervorruft, in die Gesellschaft getragen werden?
Tina Billeter: Zurzeit ist die Multifunktionalität im urbanen Kontext nicht negativ konnotiert. Sie zielt aber auf eine Mehrfachnutzung von limitierten Ressourcen und Räumen (z.B. Mindestbelegungsvorgabe in städtischen Wohnungen). Die ‚Stadt der kurzen Wege‘ klingt ebenfalls nach Lebensqualität: Erholungsräume in unmittelbarer Umgebung, Einkaufsmöglichkeiten und Märkte in Gehdistanz, Arbeitswege per Fahrrad, Schulen und Bibliothek um die Ecke. Die Stadt versucht, suffiziente Massnahmen positiv erlebbar zu machen – ohne dies als Suffizienz direkt beim Namen zu nennen.
Deutsche Umweltstiftung: In welchen Lebensbereichen sollte Suffizienz Ihrer Meinung nach zuerst umgesetzt werden?
Tina Billeter: Wir müssen verstärkt auf Suffizienz-Massnahmen setzen, wo die grösste Treibhausgasreduktion bewirkt werden kann: Konsum, Gebäude, Mobilität.
Deutsche Umweltstiftung: Die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft sind schon seit gut zehn Jahren in der Stadtplanung verankert. Was hat sich seither getan? Welche Erfolge konnten erzielt werden?
Tina Billeter: Pro Person konnte in den vergangenen zehn Jahren der Primärenergieverbrauch um rund 20 Prozent auf 3500 Watt und der jährliche Treibhausgasausstoss um zehn Prozent auf 4.4 Tonnen reduziert werden. Wichtige städtische Strategien wie der Masterplan Energie, Masterplan Umwelt, Verkehr2025 oder die 7-Meilen-Schritte bezüglich Gebäude wurden zielkonform angepasst. Der Kommunale Richtplan ist erarbeitet; viele zertifizierte 2000-Watt-Areale wurden errichtet. Die Beschaffungskoordination sowie die Pensionskasse arbeiten mit strengen Nachhaltigkeitskriterien. Den Bürgern wird automatisch Ökostrom geliefert: nebst der Wasserkraft wird die Solar- und Windkraft gefördert. Das Kehrichtheizkraftwerk versorgt bereits Zehntausende von Wohnungen mit Wärme und Strom und das Fernwärmenetz wird erweitert. Erste stadteigene Gebäude wurden gemäss dem Label Minergie-P-Eco gebaut und produzieren mehr Energie als sie benötigen. Die Beratungsstelle Energie-Coaching begleitet Private beim Heizungsersatz respektive beim Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger. Der Öko-Kompass berät KMUs im allen Umweltbelangen. Fuss- und Velowege sowie das öffentliche Verkehrsnetz werden stetig ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Erfolg ist sichtbar: Bereits mehr als die Hälfte aller Zürcher Haushalte besitzt kein Auto mehr.
Deutsche Umweltstiftung: Wie kann das Konzept von anderen Städten/Gemeinden adaptiert werden?
Tina Billeter: Das Bilanzierungskonzept ist öffentlich verfügbar. Die nationale Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft berät interessierte Gemeinden. Schweizweit wurden bereits 45 Gemeinden mit dem Label ‚Energiestadt Gold‘ ausgezeichnet – sie alle befinden sich ebenfalls auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft.
Über die Interviewpartnerin

Tina Billeter, diplomierte Umwelt-Naturwissenschaftlerin ETH, ist als Senior Projektleiterin Energiestrategie im Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich tätig.