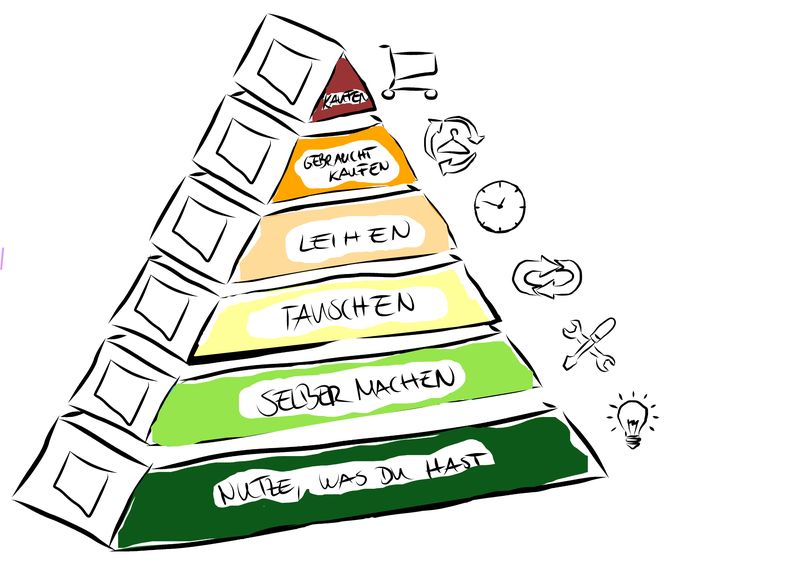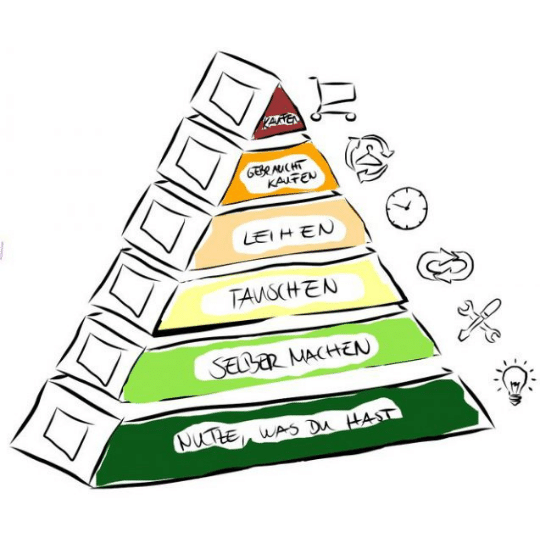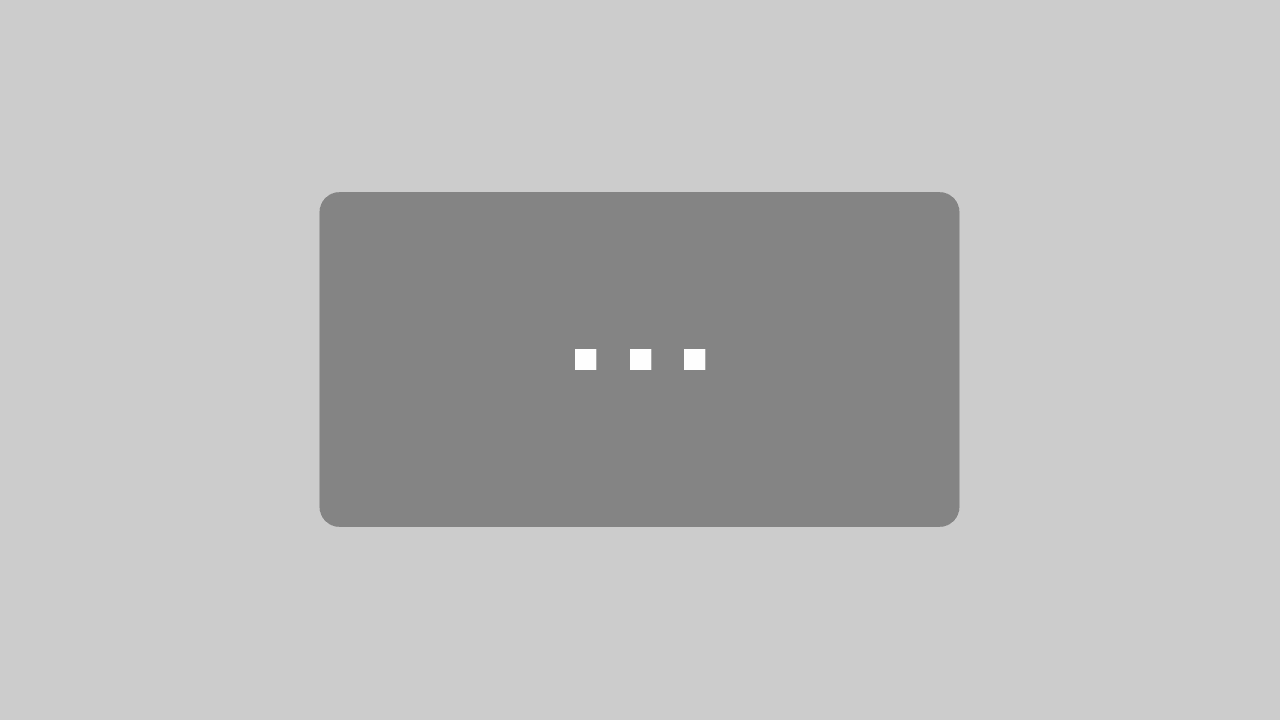Eigentlich geht der Trend der Wohnfläche in den letzten
Jahrzehnten steil aufwärts. 2018 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro
Kopf in Deutschland 46,7 Quadratmeter, in den USA sogar bis zu 74 Quadratmetern
(Umweltbundesamt, 2019; Boeckermann, 2017). In den Besitzmaximierung gesprägten
Konsumgesellschaften sind Häuser und ihre Größe immer mehr zum Statussymbol
geworden. Dazu im Gegensatz steht die Tiny House Bewegung. In kleinen, meist
mobilen, Häusern leben die Menschen auf geringstem Raum mit möglichst wenig
Besitz. Gründe dafür sind die immer stärker steigenden Kosten der Anschaffung
und Erhaltung von Immobilien, vor allem in Ballungsgebieten, der Wunsch nach
mehr Mobilität und Selbstverwirklichung und die Überdenkung des eigenen
Lebensstils und des eigenen ökologischen Fußabdrucks (Biron).
Tiny Houses gibt es in verschiedenen Größen, doch ihrem
Namen bleiben sie alle treu: Nur zehn bis 55 Quadratmeter groß sind die meisten
Häuser. Sie werden häufig auf einen PKW-Anhänger gebaut, um möglichst mobil zu
sein, aber es gibt zum Beispiel auch Tiny Houses aus Containern, die
unbeweglich sind. Auch wenn es mitttlerweile eine große Vielzahl von Varianten
und Designs gibt, ist die traditionelle Bauform mit einem Satteldach, unter dem
sich die Schlafebene befindet. Ansonsten besteht das Tiny House meist aus einem
großen Raum, der Küche und Wohnzimmer vereint. Typische Einrichtungselemente
sind einziehbare Sofas, einklappbare Tische und intelligente Aufbewahrungssysteme,
um den vorhandenen Platz möglichst effizient zu nutzen. Die Badezimmer sind
ebenfalls deutlich kleiner, teilweise trotzdem mit normalen Toiletten und
Duschen ausgestattet, ansonsten mit einer Komposttoilette (Kilman, 2016).
Die Preise für Tiny Houses variieren stark nach Größe, Anbieter*innen und in welchem Zustand das Tiny House ausgeliefert wird und wie viel Arbeit man selbst hineinsteckt. So beginnt ein Rohbau-Haus in Deutschland bei ca. 18.000€ inklusive Trailer, Bodenplatte, Holzkonstruktion und Wandverkleidung. Für ein bezugsfertiges Tiny House, in das man direkt einziehen kann, sollte man jedoch mit mindestens 45.000€ rechnen. Eine Grenze nach oben gibt es, genau wie bei konventionellen Häusern, nicht (Sven und Sig, 2020).
Die Tiny House Bewegung nahm ihren Anfang am Ende des 20.
Jahrhunderts in den USA. 1998 veröffentliche die Architektin Sarah Susanka das
Buch „The Not So Big House – A Blueprint For the Way We Really Live“ und ihre
Ideen wurden zunächst vor allem von Bastlern und Aussteigern aufgegriffen und
verbreitet. Mit Hilfe von TV-Formaten, weiteren Büchern, Blogs und
YouTube-Kanälen kamen die Kleinsthäuser auch schnell im Mainstream und in
anderen Ländern an (Biron).
Ursprünglich begann die Bewegung vermehrt wegen einer
notwendigen Kostenreduktion, mittlerweile ist aber auch der Wunsch nach einem
nachhaltigen Wohnen und Leben eine große Motivation, um in ein Tiny House zu
ziehen. Doch nicht jedes Tiny House ist ein langfristiges Zuhause: Tiny Houses
werden auch vermehrt als Gästehäuser oder als Geschäftsbüros genutzt.
Auch in Deutschland ist die Bewegung schon seit längerem angekommen. Um sich für die Entstehung von Tiny House Siedlungen und minimalistisches Wohnen einzusetzen bilden sich Interessengemeinschaften und Vereine. Denn einfach ist die rechtliche Lage in Deutschland nicht: Ein Tiny House kann man nicht einfach hinstellen, wo man möchte. Auf einigen Campingplätze ist die Anmeldung eines Wohnsitzes zugelassen, auf jedem anderen Grundstück muss in jedem Fall ein Bauantrag gestellt werden und der geplante Stellplatz muss mit Wasser- und Abwasserentsorgung, Strom und verkehrsgerechter Anbindung an eine Straße voll erschlossen sein (Focus.de, 2019).
Im Fichtelgebirge hat sich das erste Tiny House Village
Deutschlands gegründet: Auf dem Gelände eines ehemaligen Campingplatzes befinden
sich nun 35 Grundstücke für kleine Häuser. 30 Bewohner*innen leben in diesem
Dorf, die sich Lagerfeuerplätze, Permakulturgärten und Erholungsflächen teilen.
Außerdem bieten sie ein Tiny House Hotel für Interessierte an
(tinyhousevillage.de). Laut einer Umfrage von Interhyp können sich immerhin 13%
der Deutschen vorstellen, dauerhaft in einem Tiny House zu leben (Interhyp,
2019)
Die Antwort auf die Frage, was Tiny Houses mit Suffizienz,
dem Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch, zu tun
haben, liegt eigentlich auf der Hand: Eine geringere Wohnfläche führt auch zu
einem kleineren CO2-Fußabdruck.
Gebäude sind für knapp ein Drittel aller CO2-Emissionen
verantwortlich, Tiny Houses allerdings beschränken sich nur auf das Nötigste
und nutzen den vorhandenen Platz effizient aus. Je kleiner das Haus, desto
weniger Ressourcen werden auch für den Bau und Betrieb benötigt (Schmid, 2019).
So haben kleine Häuser einen geringeren Energieverbrauch als konventionelle
Häuser, da weniger Fläche beheizt, weniger Lampen beleuchtet werden und
generell weniger Haushaltsgeräte als in einem normalen Haus benutzt werden. Die
Wissenschaftlerin und Tiny House Bewohnerin Mary Murphy stellt heraus, dass der
geringere Energieverbrauch sogar nicht nur auf die geringere Fläche
zurückzuführen ist, sondern auch darauf, dass alles auf die Bedürfnisse der
Bewohner*innen angepasst werden kann (Kilman, 2016).
Tiny Houses haben die Möglichkeit möglichst autark und damit maximal nachhaltig zu sein. Durch Solarzellen für Warmwasser, Photovoltaik-Anlagen für den Strom, Sammeln von Regenwasser oder das Verwenden einer Komposttoilette, die kein Wasser benötigt, lassen sich die CO2-Emissionen des Hauses noch weiter reduzieren.
Allerdings bedeutet das alles nicht, dass jedes
Tiny House automatisch vollkommen suffizient ist: Schlechte Dämmung, als Folge
davon, dass das Haus möglichst leicht sein soll und dicke Wände zulasten der
Wohnfläche gehen, kann zu einem hohen Energieverbrauch führen. Außerdem werden
viele Kleinsthäuser nicht als Hauptwohnsitz, sondern als Ferien- oder
Wochenendhaus genutzt und verbrauchen so zusätzliche Ressourcen. Was ebenfalls
beachtet werden muss ist, dass die ökologischen Vorteile auch an der
Lebensweise und Einstellung der Zielgruppe liegen. Wer sich für ein reduziertes
Leben im Tiny House entscheidet, lebt meist grundsätzlich auch generell schon
nachhaltiger und bewusster (Schmid, 2019).
Quellen:
Biron, B.: Kleiner Wohnen, URL: https://www.ubm-development.com/magazin/tiny-houses-sind-ein-grosser-trend-beim-wohnen/ Abgerufen am 24.02.2020.
Boeckermann, L.: Dreaming Big and Living Small: Examining Motivations and Satisfaction in Tiny House Living, 10.5.2017, URL: https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=senior_theses, Abgerufen am 24.02.2020.
Focus.de: Tiny-House-Boom in Deutschland: Nach dem Kauf beginnen jedoch die Probleme, 08.10.2019, URL: https://www.focus.de/immobilien/wohnen/tiny-house-boom-in-deutschland-nach-dem-kauf-beginnen-jedoch-die-probleme_id_11213818.html, Abgerufen am 24.02.2020.
Interhyp: Ökohaus, Tiny House und Co.: Studie zeigt Trend zu nachhaltigen und alternativen Wohnformen, 13.02.2019, URL: https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/oekohaus-tiny-house-und-co-studie-zeigt-trend-zu-nachhaltigen-und-alternativen-wohnformen.html, Abgerufen am 24.02.2020.
Kilman, C.: Small House, Big Impact: The Effect of Tiny Houses on Community and Environment. In: Undergraduate Journal of Humanistic Studies, Carleton College, 2016. URL:https://pdfs.semanticscholar.org/2732/8c4ba21b4f6ae467210ddffd3edb2da8fa4b.pdf, Abgerufen am 24.02.2020.
Schmid E.: Tiny House und Nachhaltigkeit: Wie nachhaltig sind die Mini-Häuser? 07.05.2019, URL: https://wohnglueck.de/artikel/tiny-house-nachhaltigkeit-3343 ,Abruf am 24.02.2020.
Sven und Sig: Tiny Houses: Wohnen auf kleinem Raum, 16.01.2020, URL: https://www.otto.de/reblog/tiny-houses-1308/ ,Abgerufen am 24.02.2020.
Tinyhousevillage.de: Tiny House Village, URL: https://www.tinyhousevillage.de/ Abgerufen am 24.02.2020.
Umweltbundesamt: Wohnfläche, 22.11.2019, URL: https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche#zahl-der-wohnungen-gestiegen Abgerufen am 24.02.2020.