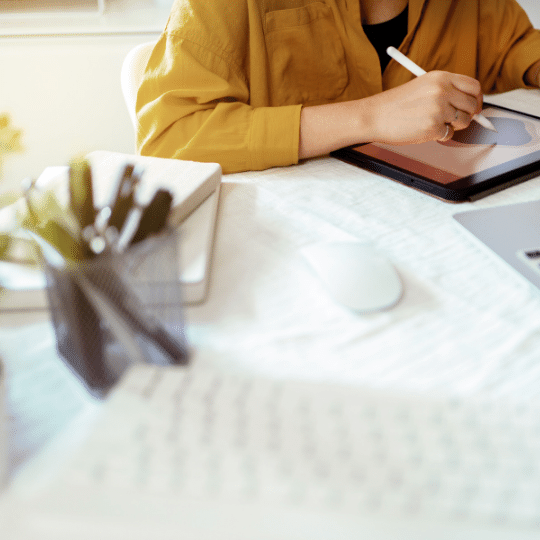Sharing Economy – die „Ökonomie des Teilens“ ist eine alternative Form des Wirtschaftens, bei der ein Wandel vom Besitz zum Gebrauch von Gütern stattfindet. Somit können mehrere Personen ein Produkt benutzen, ohne dabei die Anschaffungskosten tragen zu müssen. Durch das gemeinsame Nutzen von Gütern und Dienstleistungen sollen ökologische und soziale Aspekte positiv beeinflusst werden.

Es gibt verschiedene Stimmen zu der Intention und Auswirkung von Sharing-Plattformen. Zum einen wird die Sharing Economy als soziale Bewegung wahrgenommen, die eine menschlichere Wirtschaft anstrebt, bei der Werte wie Solidarität, Kooperation und Gemeinschaft zählen. Die Teilungspraktiken werden in dem Sinne als Reaktion auf die traditionelle westliche Konsumkultur wahrgenommen (Ranchordas, 2015). Zum anderen gibt es auch kritische Stimmen, die meinen es sei ein neoliberaler Ansatz (Peitz et al., 2016). Denn durch die neu entstandenen Online-Märkte können Unternehmen gesetzliche Regulierungen umgehen und somit Kosten einsparen, was konkurrierende Unternehmen vom Markt verdrängt. Es entstehen Probleme beim Verbraucher- und Datenschutz, welche gesetzlich noch nicht geregelt sind und zunächst zu einem Verbot der Unternehmen führen kann (Peitz et al., 2016).
Demzufolge ist die Motivation sowohl von Seiten des Anbietenden als auch die des Nutzenden für die sozialen und umweltrelevanten Auswirkungen ausschlaggebend. So ist die Motivation bei Plattformen wie Carsharing eher ökonomischen Interessen zuzuordnen, während angenommen wird, dass beim Teilen von Werkzeugen soziale Motivationen überwiegen (Böcker et al., 2017). Zum Beispiel gibt es viele nicht-kommerzielle Plattformen, die zur Sharing Economy gezählt werden. Auf diesen Seiten können Besitzer*innen Güter, die sie nur selten nutzen, kostenlos verleihen. Ein Beispiel hierfür ist die Plattform berlin.fairleihen.de, auf der Büchern, Fahrräder, Haushaltsgeräte und vieles mehr kostenlos verliehen werden. Weitere Positivbeispiele für Sharing Economy sind auf der Utopia Website aufgeführt. Zudem variiert die Motivation je nach sozial-demographischem Hintergrund, sowie zwischen dem Anbietenden und Nutzenden (Böcker et al., 2017).
Die Weiterentwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen sowie die Fortentwicklung von globalen Internetdiensten befördert die Sharing Economy. Plattformen wie Uber im Transportsektor und Airbnb in der Unterkunftsvermietung erweitern Angebote etablierter Branchen (Peitz et al., 2016). Hinzu kommt, dass Sharing-Dienste oftmals Güter mit hohen Anschaffungskosten anbieten, da sich andernfalls der Erwerb für die Privatperson nicht lohnen würde.
Ein weiteres Element ist, dass Vertrauen zwischen den beiden teilenden Parteien eine größere Rolle einnimmt. Viele Plattformen enthalten unterstützend Bewertungs- und Ratingsysteme, die Vertrauen aufbauen und Informationen asymmetrisch aufbauen. Bei einer Wohnungsvermietung sollte bspw. die mietende Person sicher sein, dass die Wohnung entsprechend der Fotos aussieht und die vermietende Person davon ausgehen können, dass mit der Wohnung ordnungsgemäß umgegangen wird.
Im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung kann über Sharing Economy keine pauschale Aussage getroffen werden, da es auch vom Nutzungsverhalten der Konsumierenden abhängig ist. Wenn Menschen, die zuvor in Hotels übernachtet haben nun stattdessen eine Wohnung über Airbnb mieten, kann der negative Effekt auf die Umwelt geringer ausfallen. Verleitet das günstige Angebot jedoch dazu mehr und vorwiegend mit kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen zu Reisen, dann wird die Umwelt noch mehr belastet. Somit ist es wichtig, den geringeren Ressourcenverbrauch, welcher durch das Teilen entsteht, gegen die erhöhte Nutzungsintensität und damit den auftretenden „Rebound-Effekten“ abzuschätzen. Rebound Effekte können bspw. auch beim Carsharing auftreten. Laut einer Studie ersetzt ein Carsharing Auto acht private PKWs. In der Rechnung würde das zu weniger Parkplätze in der Stadt führen und Ressourcen für die Herstellung der Autos einsparen. Eine Studie des Ökoinstitutes zeigte allerdings, dass nur wenige Carsharing Nutzer*innen ihr eigenes PKW verkaufen. In Köln und Frankfurt wurden für jedes eingesetzte Auto der Carsharing Plattform car2go 0,3 bis 0,7 private PKWs abgeschafft. Das heißt, die Anzahl an PKWs erhöhte sich sogar durch Carsharing Plattformen.
Das Konzept der Sharing Economy hat großes Potenzial, Ressourcen zu schonen. Ob es aber wirklich zu Einsparungen kommt, hängt sowohl von den Verleihenden als auch den Nutzenden ab.
Quellen:
Böcker, L. & Meelen, T. (2017). Sharing for people, planet or profit? Analysing motivations for intended sharing economy participation. In: Environmental Innovation and societal Transition. Volume 23, S. 28-39.
Peitz, M. & Schwalbe, U. (2016): Zwischen Sozialromantik und Neoliberalismus: Zur Ökonomie der Sharing-Economy, ZEW Discussion Papers, Nr. 16-033, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim.
Ranchordas, S. (2015). Does Sharing Mean Caring? Regulating Innovation
in the Sharing Economy. In: Minnesota Journal of Law, Science & Technology. Volume 16, Issue 1, Article 9.