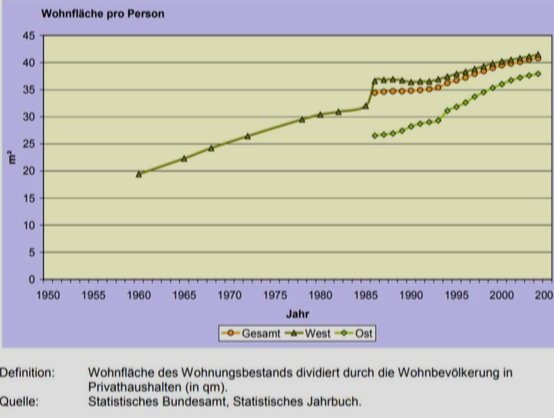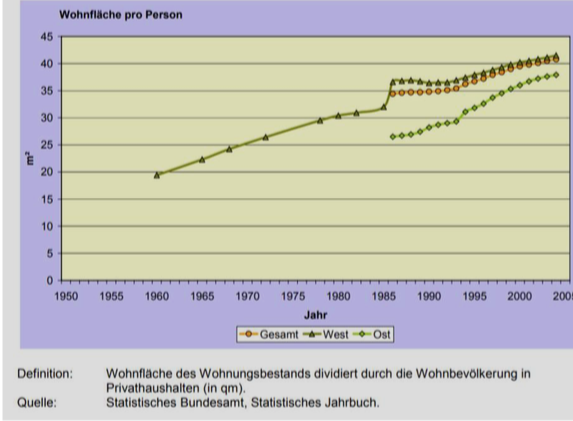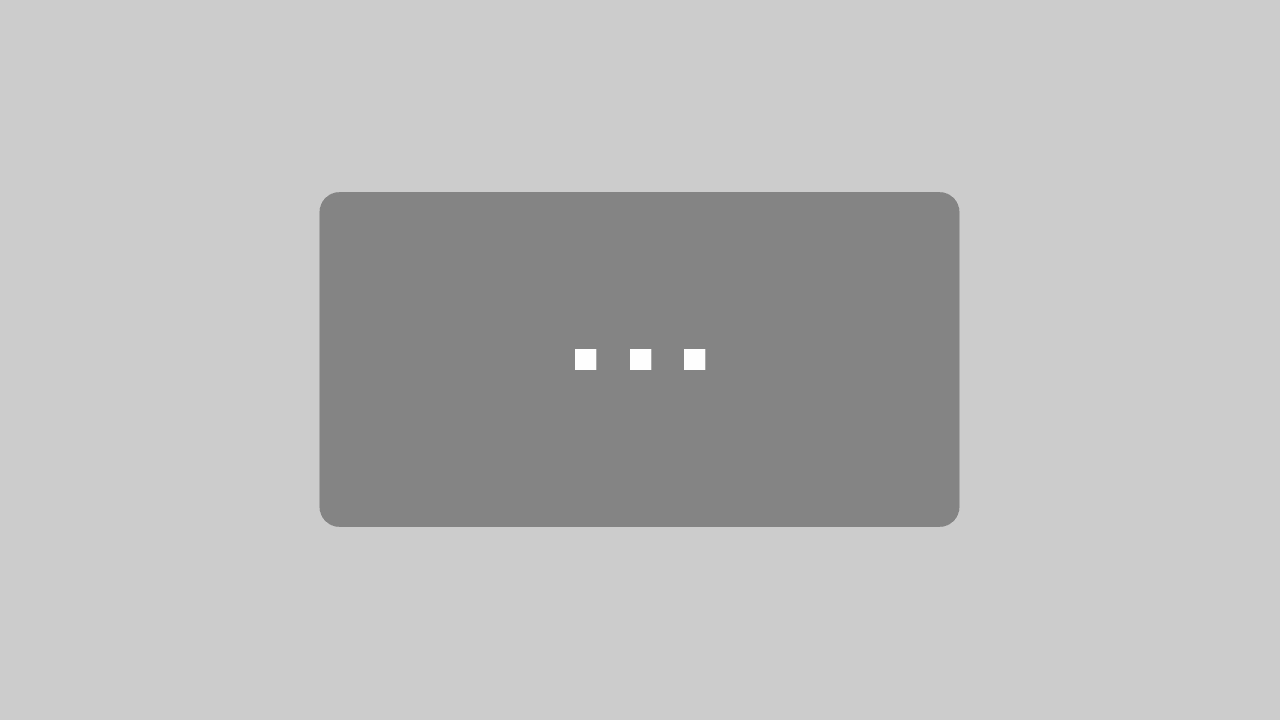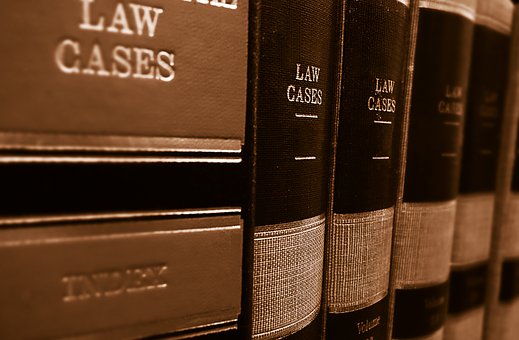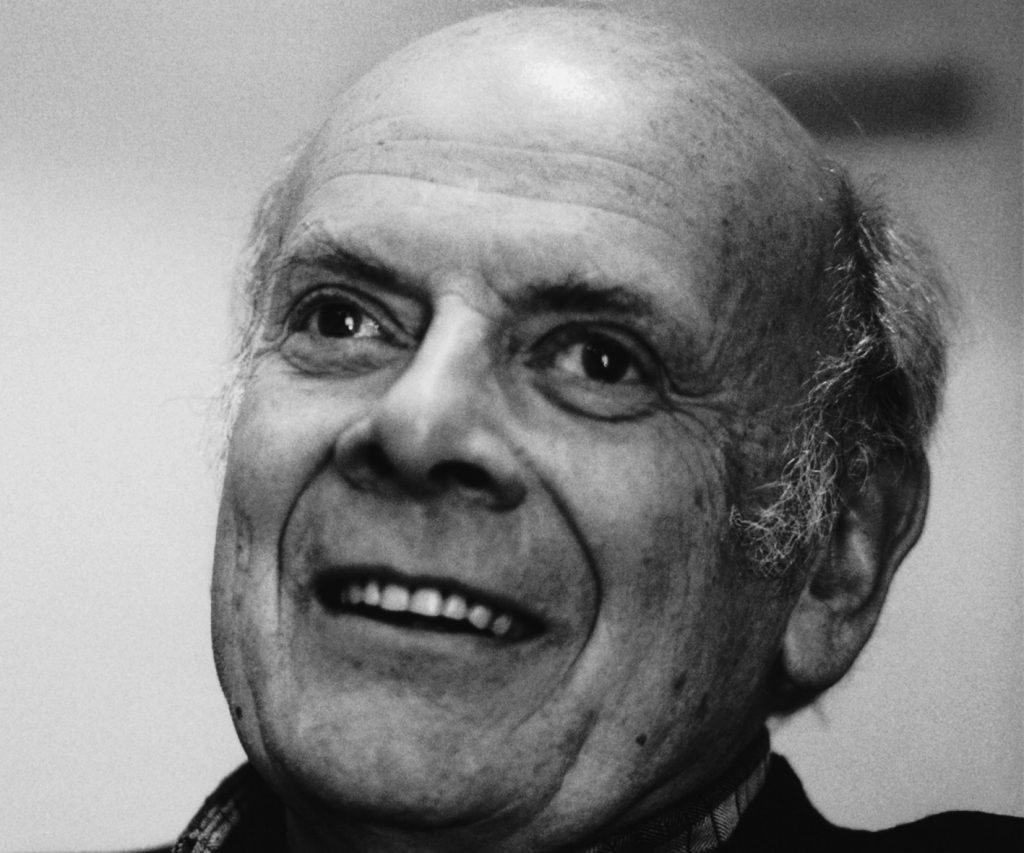#kaufnix – eine Anleitung

Seit vielen Jahren zermartern wir uns das Hirn, wie wir Menschen dafür begeistern können, nix zu kaufen und stattdessen ihr Leben zu genießen. Und wir haben eine Idee, die schon hunderten Menschen geholfen hat, alte Gewohnheiten abzulegen und neue bessere befreiende Angewohnheiten anzunehmen.
Es war Ende März, nicht gerade warm, als wir mit hängenden Schultern, einem dicken Kloß im Hals und schwerem Herzen in Hamburgs Shopping-Meile Mönckebergstraße auf einer Bank saßen. Um uns herum Tausende von Menschen mit dicken Einkaufstaschen. Und wir dazwischen. Traurig und fuchsteufelswild. Wir hatten gerade ein Experiment gemacht: Wir waren durch die Kaufhäuser und Schuhläden gezogen und hatten uns Dinge ausgesucht, die uns gefielen – und mal nachgefragt, wie diese hergestellt worden sind. Hatten die Arbeiter*innen einen fairen Lohn bekommen? Enthielten sie genmanipulierte Baumwolle? Wie waren die Tiere gehalten worden, deren Wolle zu Pullovern und Haut zu Schuhen verarbeitet wurden?
Erst fragen, dann (nix) kaufen
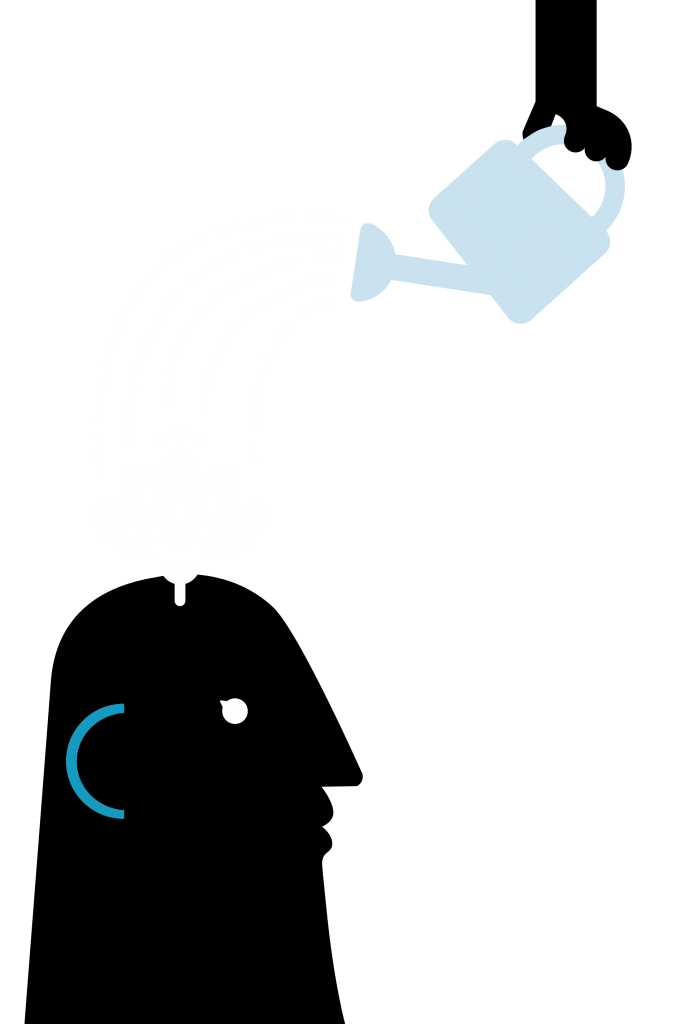
Bei all unseren Fragen nach der Herkunft der Produkte kam nur eine gruselige Erkenntnis heraus: Kein einziger Verkäufer und keine einzige Verkäuferin konnte uns dazu eine Auskunft geben. Im besten Fall wurden wir auf die Website verwiesen. Wo wir auch nichts herausfanden, wie wir später feststellten mussten. Noch schlimmer. Sie waren überrascht. Anscheinend kam also niemand von all diesen Menschen jemals auf die Idee, danach zu fragen. Und so saßen wir da in all dem geschäftigen Trubel und waren wirklich geschockt. Aber das Schlimmste: Wir waren ja nicht anders gewesen – bis zu diesem Tag.
Dieses Erlebnis veränderte in unserem Leben ziemlich viel: Erstens brachte es uns die Erkenntnis, dass wir nicht weiterhin einfach ohne zu Fragen das tun konnten, was scheinbar „alle anderen“ taten. Zweitens erkannten wir, dass Experimente eine super Möglichkeit sind, um mehr über sich, über andere und über die Welt herauszufinden. Ja, noch besser: Sie sind eine super Möglichkeit, um spielerisch das eigene Leben Schritt für Schritt nachhaltiger und fairer zu gestalten.
Veränderungen sind schwierig

Wir Menschen mögen keine Veränderungen. Das hat ganz einfache physische Ursachen. Das zumindest erklärte uns der Hirnforscher Gerald Hüther in einem Gespräch. Denn unser Gehirn verbraucht schon im Normalbetrieb sehr viel Energie. Wenn wir etwas neu denken oder gar machen wollen, dann bedeutet das also einen unheimlichen Energieaufwand. Und den versucht unser Körper aus überlebenstaktischen Gründen möglichst zu vermeiden.
Deshalb müssen wir Menschen uns schon was einfallen lassen, wenn wir etwas anders machen wollen. Vor allem, wenn es was ist, das anders ist als das, was die meisten Menschen um uns herum tun. Denn das erfordert noch mehr Aufwand, dadurch dass wir zuerst herausfinden müssen, wie es geht – und wir vielleicht auch noch gezwungen sind, uns zu rechtfertigen oder sogar mit Ausgrenzungen zurecht zu kommen.
Experimente machen Spaß

Wenn es uns also schon rein physisch schwer fällt, unser Leben zu verändern, dann müssen wir die Sache irgendwie spielerisch leicht und mit Freude angehen. Bei diesem Gedankengang angekommen, kam uns die Idee mit den Experimenten. Sie haben aus unserer Sicht einige ganz bedeutende, ja entscheidende Vorteile, die dir Veränderungen erleichtern:
- Bei einem Experiment hast du ein konkretes Ziel – du siehst also auch klar deinen Erfolg und deinen Fortschritt. Dadurch dass du möglicherweise einen Endpunkt oder zumindest Etappenziele hast, hast du immer mal wieder Zeitpunkte, an denen du innehalten und über deine Erfahrungen nachdenken kannst. Das motiviert.
- Ein Experiment kann zeitlich begrenzt sein. Du kannst dir erst mal einen bestimmten Zeitraum vornehmen. Beispielsweise einen Monat lang mit wenigen Kleidungsstücken auskommen und dann zu sehen, was du wirklich brauchst.
- Ein Experiment kann zur richtigen Zeit stattfinden und mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen. Wenn du dir also vornimmst, nur noch mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, dann beginnst du damit am besten im Sommer. Wenn du mal einen Monat lang ausprobieren willst, wie es ist, dich vegan zu ernähren, dann mach das am Besten nicht vor Feiertagen oder Familienfesten.
Und die Sache mit den Experimenten funktioniert tatsächlich: Wir haben das nicht nur am eigenen Leib erlebt. Wir haben auch die Online-Akademie „Und jetzt retten WIR die Welt“ gegründet. Hier findest du zu den unterschiedlichsten Themen sogenannte „Aktionen“ (Experimente). Die meisten haben damit zu tun, weniger zu konsumieren!
Aber #kaufnix reicht nicht
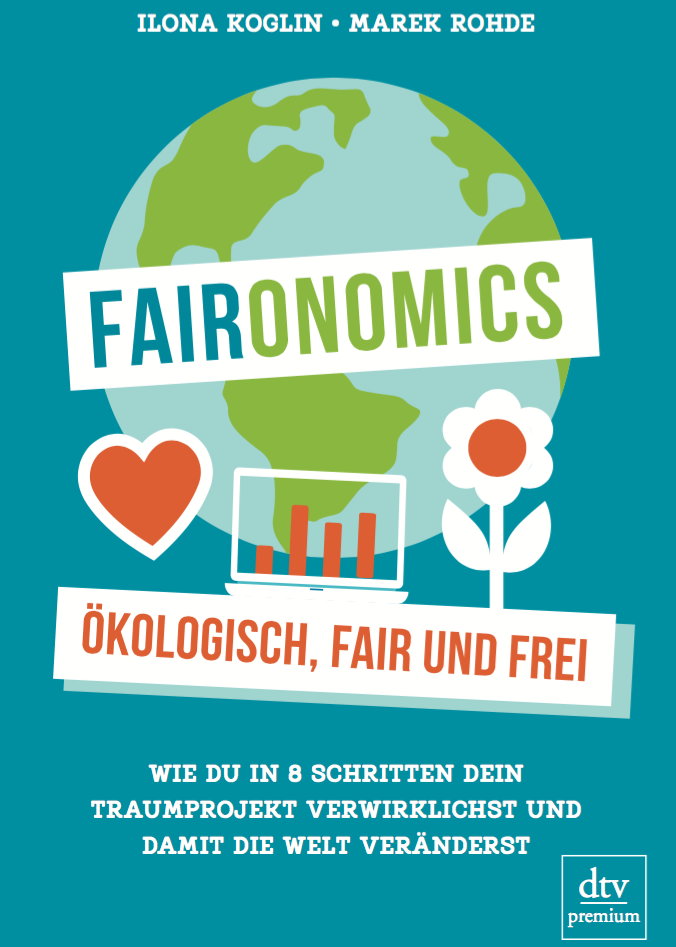
Wer jemals so ein Experiment gemacht hat, wie wir in der Mönckebergstraße bei uns in Hamburg, der weiß: Nix kaufen reicht nicht, so wichtig und wertvoll Konsumkritik auch ist. Wenn es alleine vom mühevollen Veränderungswillen der Menschen abhängt, dann wird es schwierig. Es ist für viele einfach zu schwierig, kompliziert, teuer und zeitaufwendig für jedes Produkte eine unbedenkliche Variante zu finden. In manchen Fällen gibt es diese sogar nicht.
Deshalb müssen unsere Experimente auch über den Konsum hinausgehen. Wir brauchen Menschen, die sich zu Solidarischen Gemeinschaften zusammenschließen. Wir brauchen Menschen, die auf die Straße gehen, um sich für die Rechte von Menschen, Tieren und Natur einzusetzen. Und wir brauchen Menschen, die Bürgerinitiativen, öko-soziale Unternehmen und andere Organisationen gründen, die Alternativen fordern und schaffen. Um diese Menschen dabei zu unterstützen, haben wir die Plattform faironomics gegründet. Dort bauen wir in den kommenden Wochen und Monaten ein Informationsarchiv auf, in dem du Methoden, Konzepte und Ideen für eine öko-faire Ökonomie (Faironomics) findest.
Denn wir sind überzeugt: Noch nie standen die Chancen für uns hier in Deutschland so gut wie heute, eine faire und umweltfreundliche Gesellschaft gemeinsam zu schaffen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wir brauchen dazu viele Menschen, die viele kleine oder auch größere Schritte gehen. Das Ganze ist ein Experiment. Ein fraktales Experiment, um genau zu sein. Denn in dem Großen stecken viele kleine Experimente — für jede*n Einzelne*n von uns. Sie warten nur auf deinen Mut und deine Experimentierfreude.
Über die Autoren

Ilona Koglin und Marek Rohde erforschen als freie Buchautor*innen, Journalist*innen und Medienaktivist*innen seit vielen Jahren, wie es sich anders besser wirtschaften lässt. Dazu befragen sie auch viele Querdenker*innen und Vorreiter*innen – seit 2007 zum Beispiel in ihrem Blog oder der „Konferenz für eine bessere Welt“ (2014, 2018, 2020). Daneben sind Ilona Koglin und Marek Rohde gefragte Projektberater*in und -begleiter*in für öko-soziale Gründungen, Unternehmen, Organisationen und Gemeinschaften. In ihren Büchern verweben sie ihre eigenen Lernerfahrungen mit den Erkenntnissen aus ihren Projektbegleitungen und mehreren Hundert Interviews mit internationalen Change-Makern.
Weiterführende Literatur
Koglin, Ilona/Rohde, Marek: Und jetzt verbessern wir die Welt. Wie du die Veränderung wirst, die du dir wünschst. Stuttgart: Franckh-Kosmos, 2016.
Koglin, Ilona/Rohde, Marek: Faironomics. Ökologisch, fair und frei Wie du in 8 Schritten dein Traumprojekt verwirklichst und damit die Welt veränderst. München: dtv Verlagsgesellschaft, 2019.