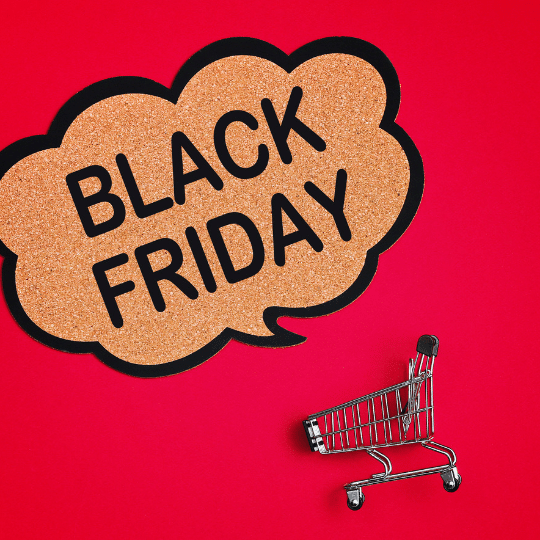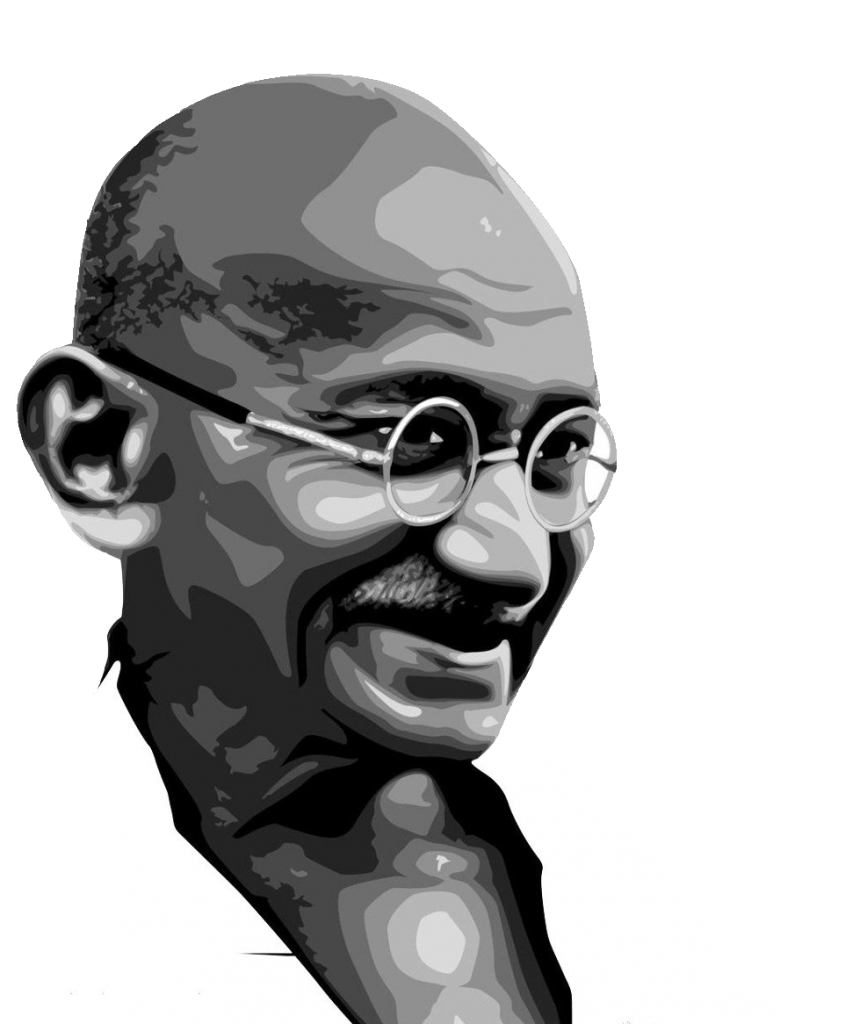Der Freitag nach Thanksgiving ist für viele Menschen ein Tag des extremen Konsums geworden. Ursprünglich aus den USA kommend, gibt es den Black Friday seit einiger Zeit auch in Deutschland. Aus welchen Gründen genau der Tag entstanden ist und wieso er Black Friday heißt, ist nicht vollständig belegt. Oft wird auf die Geschäftsinhaber verwiesen, die nach Thanksgiving endlich wieder schwarze, statt rote Zahlen schrieben. Offensichtlich waren die Verbraucher durch den Feiertag und das anstehende Weihnachtsfest, zu einem höheren Konsum bereit. Eine andere Erklärung für den Black Friday stammt aus Philadelphia in den 50er Jahren. Dort sollen Polizisten das durch Touristen und Shopper entstandene Chaos in der Stadt am Tag nach Thanksgiving, als Black Friday bezeichnet haben. Diese konnten sich den Tag nicht freinehmen und mussten oft extra lange Schichten arbeiteten, um die wegen dem Army-Navy football game in die Stadt gekommen Menschenmassen, unter Kontrolle zu bringen. (Pruitt, 2015)
Eine fundierte Erklärung und Rechtfertigung für den übermäßigen Konsum an diesem Tag, gibt es demnach nicht. Sicher ist jedoch, dass der Black Friday nicht ohne erhebliche negative Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Produzenten stattfinden kann. Denn das Prinzip ist einfach: Anbieter werben mit Schnäppchen-Preisen, reduzierter Ware und „Top-Deals“, die es im restlichen Jahr nicht gibt. An jeder Ecke wird zu einem ausnahmslosen Konsum aufgerufen und die Verbraucher kaufen und bestellen reichlich. Im letzten Jahr gaben Bürger aus Deutschland an, im Schnitt 200 Euro am Black Friday ausgeben zu wollen. (Rabe, 2019) Die größten Verkaufsbereiche sind hierbei Mode und Accessoires, Kosmetika und Drogerieartikel, sowie technische Haushaltsgeräte. (Suhr, 2019) Der Umsatz am diesjährigen Black Friday und Cyber Monday, soll laut Handelsverband Deutschland bei 3,1 Milliarden Euro liegen. Das ist eine Steigerung von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. (IFH Köln, 2019)

Dieser Konsumwahnsinn endet zum Großteil in unbedachten Käufen von Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Die „Wegwerfgesellschaft“ findet einen weiteren Anreiz blind zu konsumieren- ohne Gedanken an mögliche Folgen. Denn für die billig Preise zahlen andere – die Löhne in den meisten Herstellungsfabriken sind sehr gering und Sicherheitsstandards selten gewährleistet. (Gmeiner, 2019) Viel Konsum bedeutet außerdem auch viel Verpackung und viel Müll. Deutschlands pro Kopf Verbrauch an Plastik- und Verpackungsmüll ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Ein wesentlicher Grund dafür sind Online-Einkäufe, die uns einschließlich hohem Emissionsverbrauch, bis vor die Haustür geliefert werden. Häufig werden diese Produkte wieder zurückgeschickt, woraufhin sie ungenutzt vernichtet oder weggeworfen werden. Die Greenpeace Sprecherin Viola Wohlgemuth, bezeichnet den Black Friday daher passend als „schwarzen Tag für die Umwelt“. (Miller, 2018)
„Kauf Nix Tag“ und „Whitemonday“ – den Konsum in Frage stellen
Doch es gibt auch Bewegungen und Initiativen gegen den Massenkonsum. Der „Kauf Nix Tag“ wurde Anfang der 90er von Ted Dave in Vancouver ins Leben gerufen. Er findet am Samstag nach dem Black friday statt und ruft als Pendant dazu auf, einen Tag ohne Konsum zu verbingen. Im Mittelpunkt soll an diesem Tag der bewusste Umgang mit Ressourcen und unserer Umwelt stehen, sowie eine Infragstellung des eigenen Lebensstils: Brauche ich dieses Produkt wirklich? Kann ich mir es vielleicht ausleihen oder gebraucht besorgen? Kann mich immaterielles nicht genauso glücklich machen? (Knirsch, 2008)
Der „White Monday“ ist eine neuere Bewegung aus Schweden, die Kreislaufwirtschaft und Kreislaufkonsum als Strategie sieht. Er findet seit 2017 am Montag vor dem Black Friday statt. Wege zum Teilen, Mieten, Reparieren, Recyclen, Leihen und Upcyclen werden von Organisationen, Influencern und individuellen Teilnehmern online und offfline verbreitet. Der Konsum wird hierbei nicht komplett ausgeschlossen, aber nur bereits im Kreislauf vorhandene Güter sollen konsumiert werden. (whitemonday.info)

Es gibt ausreichend Gründe, den Black Friday dieses Jahr ausfallen zu lassen und im Gegenzug den eigenen Konsum zu betrachten. Dabei geht es nicht grundsätzlich um kompletten Verzicht, sondern viel mehr um die Frage, wie man konsumiert. Ein bewusster Umgang mit Produkten und ein gesundes Maß an Genügsamkeit, trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern reicht oft auch zum glücklich sein.
Quellen:
Gmeiner, E.: „Black Friday: Schwarzer Tag für nachhaltigen Konsum Transfair fordert ein verbindliches Lieferkettengesetz“ in: Internetseite Presseportal, 26.11.2019, URL: https://www.presseportal.de/pm/52482/4450536, Abgerufen am 27.11.2019
IFH Köln im Auftrag vom Handelsverband Deutschland: „Black Friday und Cyber Monday“ in: Internetseite Handelsverband Deutschland, 2019, URL: https://einzelhandel.de/blackfriday#pagetop, Abgerufen am 27.11.2019
Knirsch, J.: „Erde retten statt Konsumieren“, Hamburg, 11/2008, URL: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Kauf_nix_Tag_2008_0.pdf, Abruf am 27.11.2019
Miller, S.: „Nicht nur am „Black Friday“: Bestellen für den Müll“ in Internetseite: Greenpeace, Hamburg 16.11.2018, URL: https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/nicht-nur-am-black-friday-bestellen-fuer-den-muell, Abruf am 27.11.2019
Priutt, S: „What’s the Real History of Black Friday?“ in: Internetseite History, 20.11.2018, URL: https://www.history.com/news/whats-the-real-history-of-black-friday, Abruf am 27.11.2019
Rabe, L.: „Durchschnittliche geplante Ausgaben pro Kopf am Black Friday in ausgewählten Ländern weltweit im Jahr 2018“ in: Internetseite Statista, 26.11.2019, URL:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/943683/umfrage/durchschnittliche-ausgaben-am-black-friday-in-ausgewaehlten-laendern-weltweit/, Abruf am 27.11.2019
Suhr, F.: „Was die Deutschen am Black Friday kaufen“ in: Internetseite Statista, 26.11.2019, URL: https://de.statista.com/infografik/20107/meistgekaufte-produkte-am-black-friday-in-deutschland/, Abruf am 27.11.2019
Whitemonday, FAQ – Website, URL: https://www.whitemonday.info/about, Abruf am 27.11.2019