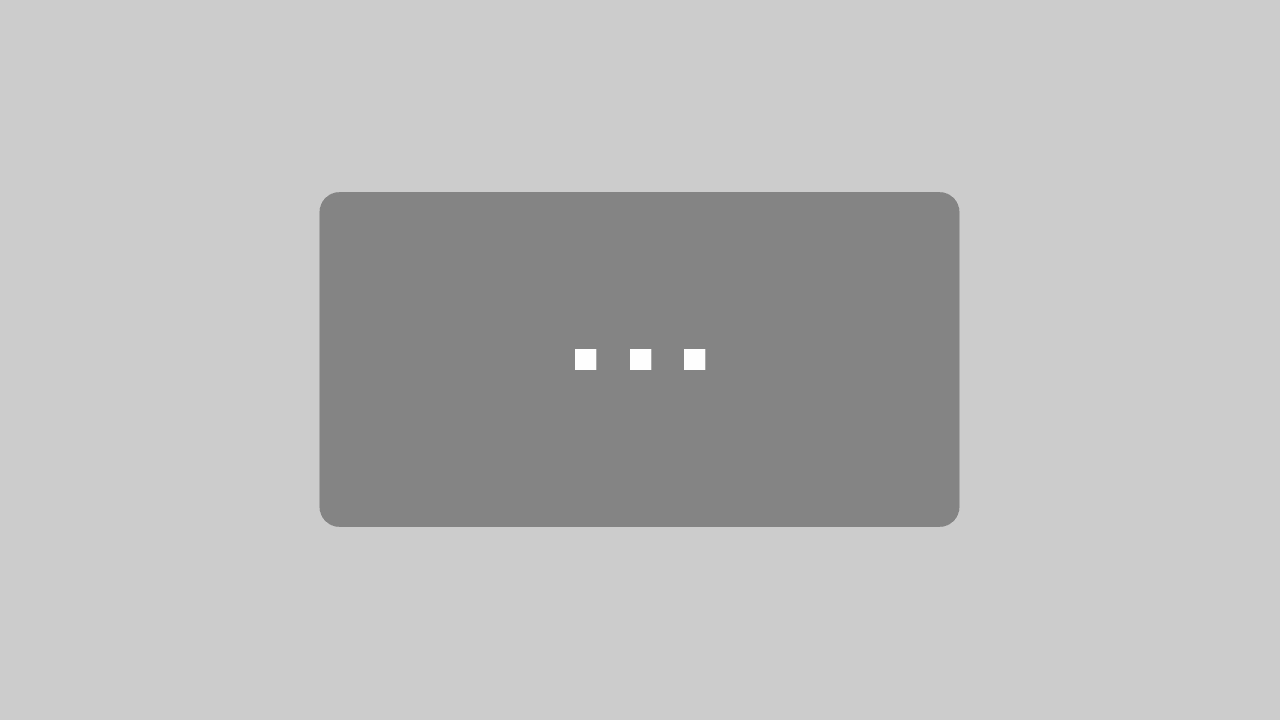Sieben Wochen betrachteten wir aus verschiedenen Perspektiven die Themen Konsum, Wachstum sowie Suffizienz.
Ist das Kunst oder kann das weg? – Interview mit Thomas Reutter
Das Künstlerkollektiv Industrietempel nutzte 2017 das Jubiläum eines Müllheizwerks für Konsumkritik der etwas anderen Art. Im Rahmen einer einstündigen Werksführung zeigte das Kollektiv häppchenweise seinen Film „Die Apologeten des Wachstums“, eine feingefühlig zusammengesetzte Videocollage frei verfügbarer Youtube-Clips.
Shoppingbegeisterte Influencer*innen, Hot-Dog-Wettesser*innen und vom Wachstum predigenden Politiker*innen tragen die Botschaft beinahe ungesagt durch den Film: Der alltägliche, uns selbstverständliche Welt des Konsums ist längst zur besorgniserregenden zur Farce geworden. Wir haben uns mit Projektleiter Thomas Reutter unterhalten, der die „Apologeten des Wachstums“ initiiert und umgesetzt hat.
Deutsche Umweltstiftung (DUS): Ihr Film Film „Apologeten des Wachstums“ fängt unser tägliches Konsumverhalten in realsatirischer Weise ein. Welche Kritik versteckt sich dahinter?
Thomas Reutter: Unser Konsum und unser Glaube an Wirtschaftswachstum hat doch schon religiöse Züge angenommen. Das wollte ich mit dem Film vorführen: Wie absurd ist es denn, sich von ständig steigenden Produktions- und Absatzzahlen die Erlösung zu erhoffen? Ist es nicht Wahnsinn, wie die Leute eine Primark-Filiale zur Eröffnung stürmen? Warum? Da wird ja nichts verschenkt. Macht kaufen glücklich? Und macht mehr kaufen glücklicher? Mit den Konsumrausch-Folgen beschäftige ich mich als ARD-Fernsehjournalist seit 1998: Ausbeutung, Umweltzerstörung, Klimakrise… alles ist tausendfach berichtet. Wir kennen die Folgen. Deswegen habe ich im Film auch auf die Bilder von Müllbergen und Plastik im Meer verzichtet.
Aber: Warum predigen Politiker trotzdem immer noch das Credo vom Wachstum als Lösung aller Probleme? Es muss wirklich so eine Art Religion sein. Das wollte ich zeigen. Einmal keine Zahlen, Fakten, Studien! Vielleicht liegt der Schlüssel zur Veränderung auf der emotionalen Ebene, nicht auf der rationalen. Auf mich wirken die Bilder von den Hot-Dog-Helden und den Shopping-Queens wie Karikaturen. Wir haben die Konsumexzesse, den Kaufrausch, die Fresswettbewerbe deshalb mit eigens komponierter sakraler Musik und Zeitlupen überhöht. Vielleicht wird aus der Überzeichnung klar, wie grotesk unsere Konsumauswüchse geworden sind. Auch wenn ich nicht konsumsüchtig bin und meine Einkäufe nicht auf YouTube präsentiere, erkenne ich mich womöglich in den Karikaturen wieder, wie in einem Zerrspiegel.
DUS: Sie selbst sind Mitglied des Vereins „Industrietempel“. Der Name legt nahe, dass Industriestätten mehr zu bieten haben als Maschinen und Herstellungsprozesse. Wurden die „Apologeten des Wachstums“ deshalb zuerst in einem Müllheizwerk gezeigt?
Als ich den Kulturverein Industrietempel vor 30 Jahren mitgegründet hatte, gab es bei uns in Mannheim noch viele leerstehende Fabrikhallen. Manche hatten Fenster wie in Kirchen und verlassen wirkten die Anlagen auf uns, wie versunkene Tempel der Industrie. Die Produktionsstätten lagen da, wie vergessene Kultstätten. Inzwischen wurden sie abgerissen oder umgewidmet. Und wir bespielen nun auch Anlagen, die voll in Betrieb sind. Ins Müllheizkraftwerk sind wir gegangen, weil dort die Reste unseres Konsums liegen und verbrannt werden. Unglaubliche Mengen.
DUS: Funktioniert die Kombination aus drastischen Videobildern und echten Müllbergen? Mit welchem Fazit sind die Besucher*innen aus dem Projekt gegangen?
Reutter: Für mich war es richtig, Die Apologeten des Wachstums auf den Kontrollmonitoren der Müllverbrennungsanlage zu zeigen, auf den Bildschirmen der Kranführer, die den Müll in die Verbrennungsöfen hieven und sie an die Wand des Müllbunkers zu projizieren. So hatten die Zuschauer die Zusammenhänge ständig im Bewusstsein, ohne dass im Film auch nur einmal das Wort „Müll“ fallen musste.
Ich habe bei den Vorführungen oft in die Gesichter der Betrachter geschaut. Viele staunten ungläubig, manche ekelten sich oder schüttelten die Köpfe. Der Film hat aber auch in einer Kirche und in Schulen starke Reaktionen hervorgerufen. Das persönliche Fazit der Zuschauer*innen wird sicher erst mal sein: so verrückt bin ich zum Glück nicht! Aber vielleicht ertappt man sich dabei, auch selbst anfällig zu sein, für Konsumrausch und den unbeirrbaren Glauben an Wachstum.
DUS: Die Führungen durch das Müllheizwerk waren auf dessen Jubiläum beschränkt und den Film kann vorerst nur noch auf YouTube ansehen. Shoppende Youtuberinnen, Foodporn und Hot-Dog-Wettessen gibt es nach wie vor. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit Ihrer Konsumkritik ein?
Reutter: Die Wirksamkeit lässt sich nicht messen. Ich bin mir aber sicher, dass der Film beim Betrachten auf der Gefühlsebene etwas auslöst. Die Bilder bleiben im Gedächtnis, verbunden mit dem Gedanken: So will ich nicht sein! Wenn das auch nur bei ein paar Leuten zum Nachdenken anregt, ist schon etwas gewonnen. Wirksamer wäre er natürlich, wenn den Film viele Menschen sehen und teilen. Mein Traum wäre eine Aufführung in den Fluren des Deutschen Bundestags, im Wirtschafts- und im Umweltministerium oder gerne auch in einer großen Mall.
DUS: In unserer #kaufnix-Kampagne fordern wir Menschen dazu auf, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und auf das Kaufen zu verzichten. Was müssen wir Ihrer Ansicht nach tun, um unsere Zukunft nachhaltig lebenswert zu gestalten?
Reutter: Ha! Jetzt komme ich mir selber schon wie ein Prediger vor. Darf ich mal den Papst zitieren? Franziskus I schreibt: „Noch ist es nicht gelungen, ein auf Kreislauf ausgerichtetes Produktionsmodell anzunehmen, das Ressourcen für alle und für die kommenden Generationen gewährleistet und das voraussetzt, den Gebrauch der nicht erneuerbaren Reserven aufs Äußerste zu beschränken, den Konsum zu mäßigen, die Effizienz der Ressourcennutzung maximal zu steigern und auf Wiederverwertung und Recycling zu setzen. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage wäre ein Weg, der Wegwerfkultur entgegenzuwirken, die schließlich dem gesamten Planeten schadet.“ (Enzyklika Laudato Si, 2015) Das ist aus meiner Sicht auch heute, vier Jahre später, noch absolut gültig und aktuell.
„Wir haben uns eingeredet, permanentes Wirtschaftswachstum sei die Antwort auf alle Fragen“, sagte Bundespräsident a.D. Horst Köhler 2009 in seiner Berliner Rede. Wir müssen uns eingestehen, dass Wachstum und Konsum nicht die Lösung unserer Probleme sind. Wenn der Film einen Impuls dazu gibt, diese herrschende Meinung infrage zu stellen, dann ist er wirksam.
Über den Interviewpartner

Thomas Reutter (1967 geboren) ist seit 1989 beim Industrietempel. Er war an mehr als 50 außergewöhnlichen Ausstellungen und Aufführungen für außergewöhnliche Räume beteiligt, meist an der Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen.
Reutter ist Redakteur und Filmemacher beim SWR. Für das ARD Politikmagazin Report Mainz berichtete er von 1998 bis 2013 auch über Themen wie Ausbeutung, Massentierhaltung und Überfischung. Für einen Arte-Themenabend arbeitet er gerade an einer langen Fernsehdoku über die weltweite Urwaldabholzung.
Jedes Individuum und alle Zusammen – ein Gastbeitrag von Corinna Vosse
Macht euch ein Bild von der Transformation!
Suffizienz statt Wachstum muss zur persönlichen, politischen und ökonomischen Prämisse werden, wenn wir nicht an unserer Maßlosigkeit zu Grunde gehen– und vorher noch mehr Schaden für die verschiedenen Ökosysteme anrichten wollen. Diese drei Ebenen müssen zusammen gedacht und bearbeitet werden, wenn wir uns in Richtung einer sozial-ökologischen Gesellschaftsorganisation bewegen wollen. Es nützt wenig, wenn umweltbewusste Individuen noch mehr Zeit und mentale Energie auf einzelne Konsumentscheidungen verwenden – solange sie in ländlichen Räumen das Auto benutzen müssen, weil es kaum ÖPNV gibt. Oder solange sie beruflich ständig angewiesen werden, Flugreisen anzutreten. Ebenso wenig hilft es, wenn Politik Verordnungen auf den Weg bringen will, die im Konkurrenzkampf der Parteien um Wähler*innenstimmen gleich wieder gekippt werden. Oder für die sofort von Lobbyist*innen der Industrie Ausnahmeregelungen durchgesetzt werden. Die Transformation eines laufenden Systems ist komplex, weil alles irgendwie zusammenhängt.
Vereinbarung zwischen Konsum und ökologischem Fußabdruck?

Auch wenn es darum geht, persönliche Handlungsmöglichkeiten zu finden, muss die politische und ökonomische Seite mitgedacht werden. Das wird sofort plausibel, wenn wir uns den Möglichkeitsrahmen anschauen, in dem wir unsere Versorgung organisieren können bzw. müssen. Viele notwendige Bedürfnisse können wir nicht ökologisch verträglich decken. Wer in einer Mietwohnung lebt, die schlecht schließende Fenster hat, wird immer viel Wärmeenergie in Anspruch nehmen – zu viel im Sinne des ökologischen Fußabdrucks. Daran kann ich alleine nicht unmittelbar etwas ändern. Leider gilt das in vielerlei Hinsicht für Konsumbereiche, die einen hohen Umweltverbrauch mit sich bringen: Wohnen, Mobilität, Ernährung.
Es ist also nicht unbedachter Konsum, der uns dahin geführt hat, wo wir nun stehen: Mitten in eine sich verschlimmernde Klimakrise, eine Zerstörung von ökologischen Lebensräumen und ein fortgesetztes Artensterben. Es ist vielmehr systemisch bedingter Konsum. Wir haben uns auf die Regeln eines zerstörerischen Systems eingestellt, unser Leben daran ausgerichtet. So gesehen sind die meisten unserer Konsumentscheidungen überlegt. Wenn die Bahnfahrt nach Zürich nicht nur doppelt so lange dauert, sondern auch noch doppelt so viel kostet, ist es rational, sich für den Flug zu entscheiden. Wenn ich auf meinem zwei Jahre alten Mobiltelefon neue Apps nicht installieren kann, ist es aus technischer Sicht geboten, ein neues anzuschaffen.
Erschwerung sozial-ökologischen Handelns durch derzeitiges Wirtschaftssystem
Der ‚Ausstieg‘ aus diesem System ist nicht einmal im Ansatz möglich, solange es keine Versorgungsalternativen gibt. Aus dieser Erkenntnis heraus sind in den 70er Jahren Projekte hervorgegangen, deren Anspruch es war, unser Leben oder zumindest Teile davon so zu organisieren, dass Zerstörung verringert wird. Das betraf sowohl das soziale Miteinander als auch die Schnittstelle mit der Biosphäre – also im Wesentlichen das, was wir heute sozial-ökologische Nachhaltigkeit nennen. Heute gibt es nicht einmal mehr den Begriff des Aussteigens. Das liegt wohl daran, dass die Welt in den letzten 50 Jahren gefühlt viel kleiner bzw. voller geworden ist – und die Probleme größer bzw. global. Wohin soll man da aussteigen.
Bezogen auf unser Versorgungssystem ist dieser Zugriff allerdings weiterhin wichtig. Wenn es keine ökologisch und sozial verträglichen Versorgungsangebote gibt, müssen sie geschaffen werden – und solange Politik dies nicht durch Rahmenbedingungen fordert und fördert, wird dies kaum aus der Wirtschaft heraus geschehen. Denn da, wo ein Betrieb handelt, werden Verpflichtungen und Verbindlichkeiten eingegangen – in der Regel heißt das, jemand anderes erwartet, Geld zu bekommen. Etwas umzustellen ist in dieser Funktionslogik ein Risiko, weil es unvorhersehbare Auswirkungen auf diese kalkulierten Geldflüsse haben kann. Etwas Neues anzufangen ist schwierig, weil Forderungen laufen, auch wenn sich kein Umsatz entwickelt. Nicht von ungefähr scheitern 80 Prozent aller Gründungen.
Lokale Versorgungsarbeit als Baustein für nachhaltigen Konsum

Bleibt also, selbst tätig zu werden und jenseits der Barrieren in Wirtschaft und Politik an Versorgungsalternativen zu arbeiten. Dafür gibt es viele gute Beispiele, wie Foodsharing, Repair Cafes, Tauschläden. Wenn gesellschaftlich wirksame Ideen zum richtigen Zeitpunkt erlebbar werden, entwickeln sie sich weiter, werden aufgegriffen, mit Engagement belebt, durch Verordnungen unterstützt und in Form von Unternehmen skaliert. Natürlich setzt die Skalierung voraus, dass Politik die Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Aktivität ganz grundsätzlich verändert, indem sie für Märkte klar an ökologischen Zielen ausgerichtete Regeln aufstellt.
Deutlich wird anhand dieser Überlegungen, dass Subsistenz oder Eigenarbeit als Bestandteil sozial-ökologischer Transformation ein wichtiges, aus meiner Sicht unverzichtbares Element ist. Nachhaltiger Konsum ist nicht, ein plastikfreies Produkt im Internet zu bestellen und Fleisch durch Avocados zu ersetzen. Wenn es wirklich um eine ökologische Entlastungswirkung geht, sind wir etwas mehr gefordert. Denn dann muss die Eingriffstiefe verringert werden. Das kann man sich leicht klar machen: Ganz viele Erdbeeren zu konsumieren ist ökologisch kein Problem, wenn ich sie pflücke, wo ich bin. Auch Mobilität ist ökologisch verträglich, so lange ich mich aus eigener Kraft bewege, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. So senkt sich das Konsumniveau von ganz alleine, denn nun setze ich ja Lebenszeit und meine Arbeitskraft ein, und die sind für uns alle begrenzt – im Unterschied zum Konsumbudget vieler Menschen in westlichen Gesellschaften.
Akademie für Suffizienz in Brandenburg
Wir müssen als Gesellschaft also unsere Kraft und unsere Fertigkeit stärken, wieder Verantwortung für Versorgung zu übernehmen. Das fängt damit an, dass ich mich mit anderen zusammenschließe, ausprobiere und Erfahrungen teile. Nicht von ungefähr entstehen immer mehr Orte, wo genau dies versucht wird, Erfahrungen für ein ökologisches Wirtschaften zu ermöglichen, zu reflektieren und Bedingungen zu gestalten, dass eine andere Praxis im Alltag funktioniert. So ein Ort ist die Akademie für Suffizienz in Brandenburg, die Menschen einlädt, eine Versorgung in Kreisläufen zu erleben und die dahinter liegenden Theorien der ökologischen Ökonomie kennen zu lernen. Die Akademie ist dafür eingerichtet, Alternativen in Produktion, Verteilung und Versorgung zu erleben. Hier gibt es Raum und Zeit, um Gewohnheiten zu reflektieren, Denkmuster zu hinterfragen und das Gemachtsein unserer Wirtschaft systematisch zu durchleuchten. In der gemeinsamen Organisation des Aufenthalts vor Ort bieten sich Gelegenheiten, alte und neue Versorgungstechniken anzuwenden und für eigene Zwecke zu modifizieren. Die Akademie hat Übernachtungsmöglichkeiten, Gruppenräume, eine Selbstversorgerküche, verschiedene Werkstätten, landwirtschaftliche Versuchsfelder, eine Themenbibliothek, Obst- und Beerengarten. Im Aufbau befindet sich eine professionelle Küche für Lebensmittelverarbeitung und -konservierung. Die Nutzung dieser Möglichkeiten steht allen Interessierten offen und erfolgt auf Basis selbstgewählter Beiträge.

Neue Wege gehen bedeutet nicht zurück in die Steinzeit
Ich höre schon die Einwände, dass wir ja nicht zurück in die Steinzeit wollen. Das erscheint mir als populistisches Argument, mit dem Menschen ihre Privilegien schützen wollen. Wir nehmen uns zu viel vom Kuchen, das ist wohl kaum bestreitbar. Eine Belebung von Subsistenz setzt dem Verschiedenes entgegen: Sie führt zu einer Regionalisierung von Stoffströmen, was ökologisch eine große Entlastung bedeutet. Sie erfordert den Einsatz von Lebenszeit, was unsere Konsumzeit reduziert und damit unseren Umweltverbrauch. Sie nimmt dem hegemonialen System einer zerstörerischen Wirtschaft die Macht, weil sie Abhängigkeiten reduziert. Sie entwirft funktionierende Modelle, die schnell ein Mindestmaß an Akzeptanz gewinnen können und die dann von Politik in Verordnungen und Gesetzen verstärkt und verallgemeinert werden können.
Damit sind wir wieder beim erforderlichen Zusammenspiel der persönlichen, politischen und ökonomischen Ebene. Mir hilft es sehr in meinem Engagement, eine Vorstellung davon zu haben, wie dieses Zusammenspiel im Sinne einer sozial-ökologischen Gesellschaftsorganisation beeinflusst werden müsste, also eine Transformationstheorie zu haben, die laufend anhand von Erfahrungen und Erkenntnissen weiterentwickelt wird. So fühle ich mich getragen von dem, was ich tue, um zur Transformation beizutragen, egal, ob ich Essen rette, Artikel schreibe, Vorträge halte, Setzlinge vorziehe oder Kleidung repariere.
Über die Autorin

Corinna Vosse ist Wissenschaftlerin, Beraterin und Projektentwicklerin. Sie promovierte am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie der Humboldt Universität Berlin zu Prozessen kultureller Infrastrukturentwicklung. Derzeit übernimmt sie die Geschäftsführung der Akademie für Suffizienz, ein Reallabor für ökologisches Wirtschaften und ist gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Kulturforschung in Berlin . Außerdem leitet Vosse das Projekt für Kunst-Stoffe – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien und für die KlimaWerkstatt Spandau. Die Themenschwerpunkte liegen dabei auf Ökologische Ökonomik, soziale Innovationen, Stoffströme, Kulturentwicklung, Klimaschutz, Bildung für Nachhaltige Entwicklung BNE und Suffizienz.
BDA fordert Abwendung vom Wachstum
„Eine Konzeption von Städten, Infrastrukturen, Wohnhäusern, Fabrikations- und Bürogebäuden entscheidet, ob Menschen ihr Leben besser in Einklang mit der Umwelt bringen können.“ (BDA, Das Haus der Erde, 2019)
Nicht nur die Deutsche Umweltstiftung beschäftigt sich mit dem Thema Suffizienz, sondern auch der BDA. Der Bund Deutscher Architekten vereint circa 5.000 freischaffende Architekt*innen und Stadtplaner*innen, um diese im Interesse der Baukultur und des Berufsstandes zu verbinden. Am 15. BDA- Tag in Halle wurde kollektiv eine aktive Abwendung vom Wachstum gefordert. So plädiert das resultierende, beschlossene Positionspapier „Das Haus der Erde“ für eine Anleitungs- und Verhaltensveränderung in Bauwesen und Architektur. Das Papier konzentriert sich dabei auf zehn Punkte, die eine Abkehr vom Wachstumsmotiv in den Fokus stellen. Ganz im Sinne des Suffizienz-Gedankens werden Architekt*innen und Stadtplaner*innen aktiv dazu angehalten, die Schwerpunkte Wiederverwendung, Um-, Nach- und Mitnutzung in ihr Lebens- und Arbeitsverständnis einzubetten.

Das Positionspapier setzt in seinem Ziel auf Klimagerechtigkeit und fordert unter anderem, dass in Stadt und Land die Bewahrung von Bestehendem im Vordergrund steht, während unbedachtem Abriss vorgebeugt werden muss. Dabei soll „die Intelligenz des Einfachen“ die technische Aufrüstung zu „intelligenten Gebäuden“ ersetzen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Übermaß am Gebrauch von Dämmmaterialien eingeschränkt wird. Bezüglich der verwendeten Materialien wurde beschlossen, dass diese vollständig wiederverwendbar oder kompostierbar sein sollen, sowie dass auf kohlenstoffbasierte Materialien und fossile Brennstoffe im Bau verzichtet wird. Des Weiteren soll die Mobilität als zu gestaltendes Konzept von Architekt*innen und Stadtplaner*innen beherzigt werden, wobei die gewachsene Polyzentralität in Deutschland gestärkt werden soll, „um das konjunkturinduzierte Wachstum der Städte einerseits und den rasant wachsenden Pendlerverkehr andererseits zu begrenzen“. Zukunftsweisend soll eine „Kultur des Experimentierens“ geschaffen werden, um klimagerechte und nachhaltige Lebens- und Verhaltensarten zu erproben und zu ermöglichen.
In der aktuellen Ausgabe der db (deutsche bauzeitung, 6/2019) „Anders bauen!“ kann ausführlich über die Thematik gelesen werden. In dem Heft wird dem Stand der Forschung bezüglich neuer Materialien und ressourcenschonender Projekte nachgegangen. Auch die Betrachtung neuer, innovativer Wohnkonzepte und die Herangehensweise bei den jeweiligen Planungsabläufen stellen einen zentralen Aspekt des Magazins dar.
Fridays for Future und die #kaufnix-Kampagne
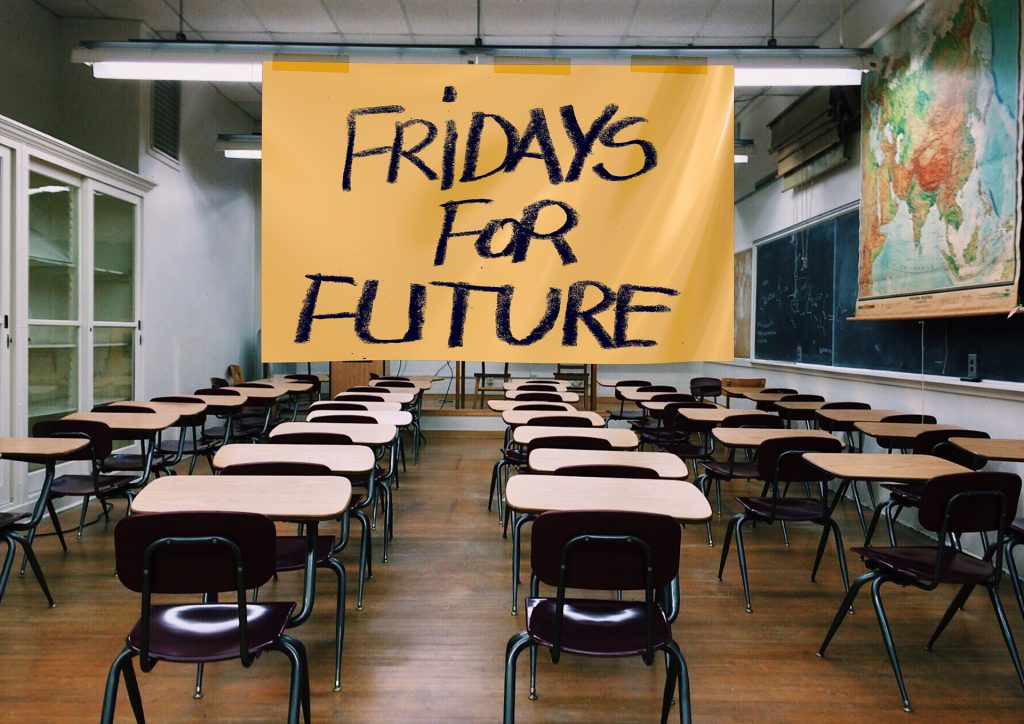
Foto: geralt/Pixabay
Zunehmend leeren sich die Klassenräume an Freitagnachmittagen. Seit einigen Monaten gehen Schüler*innen während der regulären Schulzeit in ganz Europa auf die Straßen, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Auch wir von der Deutschen Umweltstiftung waren dabei und haben regelmäßig über die rasant an Bekanntheit gewinnende Fridays-for-Future-Bewegung berichtet. Uns verbindet ein gemeinsamer Wille, Wünsche und Hoffnungen.
Aus einer Demonstration von Schulkindern haben sich mittlerweile konkrete politische Forderungen entwickelt: ,,Fridays for Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5 Grad-Ziels’’, heißt es auf der offiziellen Homepage. Außerdem sollen in Deutschland bis Ende 2019 Steuern auf alle Treibhausgasemissionen erhoben werden, ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet werden und Subventionen für fossile Energieträger ein Ende finden. Für die kommenden Jahre wird der Kohleausstieg bis 2030, eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung und eine Nettonull in der Treibhausgasbilanz bis 2035 gefordert.

Foto: GoranH/Pixabay
Weniger politische, aber genauso klimaorientierte Ziele hat auch unsere #kaufnix-Kampagne. Als Hauptverursacher der Klimakrise muss unser übermäßiger Konsum eingeschränkt werden. Und damit kann jede*r bei sich selbst beginnen, ganz ohne Politik. Ein suffizienter Lebensstil wäre also der erste Schritt jedes und jeder einzelnen, um die Stimmen der demonstrierenden Schüler*innen zu hören. Die Bremse wird gezogen, indem jede*r von uns bewusster und weniger konsumiert.
Im Rahmen unserer Kampagne lassen wir verschiedenste Akteure, die sich mit unserer grüneren Zukunft auseinandersetzen, zu Wort kommen. Ob Aktivisten*innen, Journalisten*innen, Wissenschaftler*innen, Lehrer*innen oder Schüler*innen: Gemeinsam werden unsere Stimmen lauter, sodass sie nicht mehr überhört werden können. Hierzu gehört auch Fridays for Future. Wir möchten eine Plattform bieten, auf der über die Courage und das Engagement der Initiator*innen und aller Teilnehmenden berichtet wird. Dies alles wird stetig begleitet von unserer Überzeugung, dass der Nachhaltigkeitsgedanke auf diese Weise immer mehr Menschen erreicht. Wir wünschen uns mehr Fridays for Future und bleiben weiterhin am Ball!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auf der offiziellen Webseite von Fridays for Future können Sie einsehen, wann und wo Demonstrationen in Ihrer Nähe stattfinden.